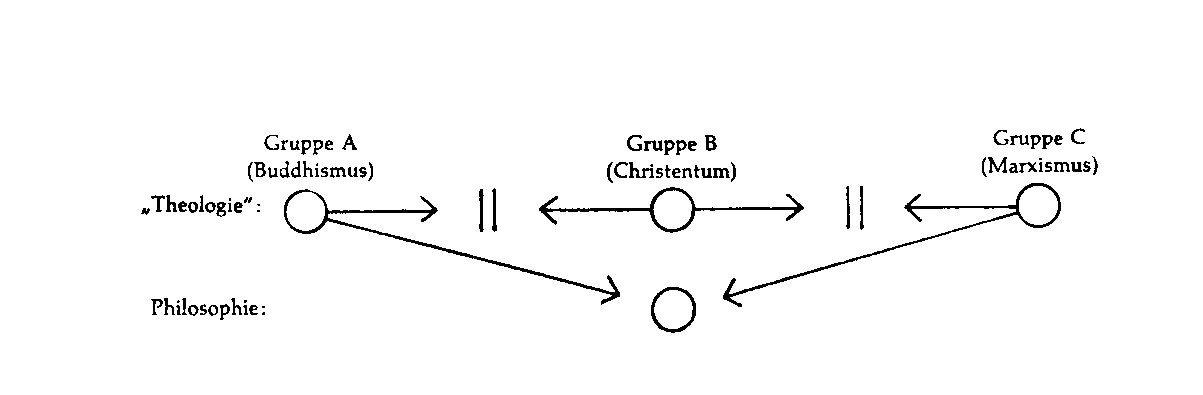
Wenn der philosophisch interessierte Leser dann aber die neue Schrift selbst aufschlägt, gerät er in Erstaunen. Er bekommt nicht etwa sogleich dieses in sich einsichtige und die früheren komplexen Überlegungen ersetzende Argument vorgelegt. Vielmehr begegnet er in dem ersten und längsten Kapitel des kleinen Werks zunächst einem weit ausholenden Gebet, das dann auch noch ins zweite Kapitel zur Einleitung des eigentlichen Beweisgangs für die Existenz Gottes fortgeführt wird.
Bei allem Verständnis dafür, daß auch Philosophen zuweilen beten - ohne dieses Verständnis hätte er sich ja kaum ausgerechnet an das Werk eines mittelalterlichen Mönchs herangemacht -, kommen selbst dem gutwilligen Leser gravierende Bedenken. Hat Anselm den benediktinischen Leitspruch "Bete und arbeite" hier nicht etwas zu weit getrieben? Der Heilige mochte sich zu Recht von Gott auch in seinem philosophischen Tun unterstützt fühlen. Wenn er sich aber an eine Gedankenarbeit macht, die aufgrund ihrer eigenen Rationalität auch dem nicht an Gott Glaubenden die Existenz Gottes zwingend vor Augen führen soll, dann kann jedes fromme Beiwerk doch nur verwirren. Es muß der Eindruck entstehen, hier werde gleich zu Eingang das theologische Rückzugsgelände für den Fall vorbereitet, daß es in der streng philosophischen Diskussion nicht mehr so recht weitergeht. Wie viel klarer faßt da nicht ganz zweihundert Jahre später ein anderer Ordensmann, der heilige Thomas von Aquin, dieselbe Sache an.
Gottes Existenz kann auf fünf Wegen bewiesen wanden. Der erste und nächstliegende geht von der Bewegung aus. Es ist nämlich sicher und durch Sinneserfahrung verbürgt, daß es in der Welt Bewegung gibt... (2).
Her sieht man, daß gleich von Anfang an die Dinge des Glaubens fein säuberlich aus den allen Menschen zugänglichen Möglichkeiten der Vernunft herausgehalten werden.
Um Anselm von dem Anschein einer zumindest methodischen Unklarheit in seinem Fragen nach Gott zu befreien, hat man vieles ins Feld geführt (3). Manches davon unterliegt selbst dem Verdacht einer Verkennung der notwendigen methodischen Grenzen zwischen Theologie und Philosophie, gerade dort, wo äußerste gedankliche Sauberkeit am meisten not täte. In all diesem Hin und Her wurde die deutliche Stellungnahme Karl Barths als wohltuend empfunden, man solle endlich diese Schmuggelei im Grenzgebiet zwischen Glaubensdenken und weltlicher Wissenschaft unterlassen. Anselm gehe es nun einmal gar nicht um Philosophie, um eine vom Glauben freie, "autonome" Vernunft. Er schreibe vielmehr als Theologe für Theologen, denen daran liegt, aus dem Innern ihres Glaubens heraus besser die klare Struktur der von der Gnade erleuchteten Vernunft zu verstehen (4). Das Gebet, das mit dem ersten Kapitel des "Proslogion" anhebt und dann in der Schrift immer wieder aufgegriffen wird, ist dann keineswegs als ein methodisches Mißgeschick zu betrachten, das dem frommen Philosophen unterlaufen wäre, und auch nicht bloß ausschmückendes, rhetorisches Beiwerk, sondern es trägt von Anfang bis Ende den ganzen Gedankengang so, daß er in Abstraktion davon nur noch verzerrt verstanden wird (5).
Nun läßt sich auch die Interpretation Karl Barths in ihrem schroffen Entgegensetzen von Theologie und Philosophie nicht halten. Anselm hatte schon im ersten
Seite 14:
Kapitel seines "Monologion" hinsichtlich dessen, was die Christen von Gott und seiner Schöpfung notwendig glauben, klargestellt: "jemand, der all das nicht kennt - sei es, daß er nicht davon gehört hat oder nicht daran glaubt -, kann meiner Meinung nach sich selbst zum großen Teil, auch wenn er nur von mittelmäßiger Begabung ist, wenigstens durch die bloße Vernunft davon überzeugen" (6). Nichts deutet darauf hin, daß Anselm jemals von dieser Ansicht abgerückt wäre (7). Der Frage nach Gott in diesem Sinne einer Möglichkeit die jedem "auch nur mittelmäßig Begabten" aufgrund seiner bloßen Vernunft offensteht (8), dienen das "Monologion" wie auch das "Proslogion". Um solches Fragen muß es auch jedem gehen, der sich um diese alten Texte müht. Sie beanspruchen, wenn auch zunächst für Theologiestudenten geschrieben, erstens eine Gültigkeit auch für den, der sich strikt auf dem rein philosophischen Standpunkt hält; zweitens einen Grad von Verständlichkeit, der sich auch dem nicht fachspezifisch Vorgebildeten erschließt. Das Problem, welchen Sinn gerade der philosophisch, das heißt nicht schon glaubend Fragende dem Beten eines Mönchs in Verbindung mit einer streng philosophisch gemeinten Argumentation abgewinnen kann, bleibt also in voller Härte bestehen. Wird F. S. Schmitt, der sich vor allem mit der kritischen Edition der Werke Anselms so verdient gemacht hat, diesem Problem ganz gerecht, wenn er meint, die spekulative, apologetische Argumentation sei für Anselm das Primäre, die Einkleidung des Gedankens in ein Gebet demgegenüber nur sekundär gewesen (9)? Daß Anselm tatsächlich zunächst wohl den "spekulativen Kern" seines neuen Gedankens schriftlich festgehalten und ihn dann erst mit einem "Gebetsrahmen" versehen hat, sagt noch nichts über die Absicht, die er mit dem fertigen "Proslogion", der "Anrede", verband. Auffallend ist, daß nicht erst Thomas von Aquin das Verfahren wählte, zunächst eine streng rationale Beweisführung ohne Rückgriff auf Glaubenswissen vorzulegen und dann erst ganz zum Schluß zu sagen: "... und dieses
Seite 15:
(Resultat des Beweises) nennen alle Gott" (10). So war schon Anselm in seinem "Monologion", dem "Selbstgespräch", vorgegangen. Erst im letzten Kapitel tauchte dort der Name "Gott" auf. Diesen "äußeren Rahmenstellt Anselm nun, kaum zwei Jahre später, im zweiten und dritten Kapitel des "Proslogion", die das angekündigte "eine Argument" für die Erkenntnis der Existenz Gottes enthalten, sozusagen auf den Kopf. Er beginnt mit einer direkten Anrede Gottes:
Also, Herr, der Du dem Glauben vernünftiges Einsehen gibst, verleihe mir, daß ich, soweit Du es nützlich weißt, einsehe, daß Du bist, wie wir glauben, und das bist, was wir glauben ...
und schließt in gleicher Weise nach Vollendung des Beweisgangs, "daß Gott ist" (11):
Und das bist Du, Herr, unser Gott ...
Ein Gebet beendet dann auch den gesamten Gedanken von Kapitel 2-4:
Dank Dir, guter Herr, Dank Dir, daß ich, was ich zuvor durch Dein Geschenk geglaubt habe, jetzt durch Deine Erleuchtung so einsehe, daß ich, wollte ich es nicht glauben, daß Du existierst, nicht vermöchte, es nicht einzusehen.
Diesen sorgfältigen "literarischen Rahmen der philosophischen Spekulation" wird man der Spekulation selbst gegenüber kaum für äußerlich halten dürfen. Wir müssen Anselm schon das Ganze, den wirklich philosophisch gemeinten Gedanken, zusammengehalten durch ein ebenso ernsthaft theologisch gemeintes Gebet, abnehmen - oder es eben als heute unverkäuflichen Ladenhüter stehenlassen. In Teilstücken wird uns, vom Autor selbst wenigstens, dieses Werk nicht angeboten.
Seite 16:
gehen] überhaupt eine positive Bedeutung sehen? Diese müßte sich dann schon aus dem Wesen philosophischen Fragens selbst ergeben.
Unter Philosophie versteht man sehr Verschiedenes. Wir können uns bei unserer Überlegung auf solches Sprechen und Denken beschränken, dem es um die Grundworte und eigentlich tragenden Begriffe alles menschlichen Daseins geht, wie "Freiheit", "Friede", ,Recht" - vielleicht auch "Gott".
Was begegnet einem, wenn er etwa über Freiheit spricht? Er meint, auf etwas Wesentliches hinzuweisen, daß alle angeht und darum eigentlich von allen begeistert aufgenommen werden müßte. Und doch muß er erfahren, daß die anderen zwar auch "Freiheit" sagen, aber etwas ganz anderes darunter verstehen. Je mehr er auf der Allgemeingültigkeit dessen beharrt, was er als Freiheit, Friede und Recht verkündet, desto mehr wird er das gerade Gegenteil des von ihm Gemeinten erfahren: Bedrohung der Freiheit, Krieg, Unrecht. Versucht er es nun, nachdem er sich so die Finger an hohen Allgemeinbegriffen verbrannt hat, mit Einfacherem, das darum allen vielleicht besser einleuchtet - mit Worten wie Brot und Haus -, so bemerkt er bald, daß er hier zwar tatsächlich leichter verstanden wird. Sobald er sich aber für dieses Einfachere einsetzt, stößt er auf den alten Gegensatz: Selbst "Brot" und "Haus" kann er nicht laut sagen, ohne daß er sich in denselben Streit begibt, der entsteht, wenn man über Freiheit", "Friede", "Recht" spricht.
Haben in diesem Streit andere Mittel als Gewalt und das "Recht des Stärkeren" eine Chance? Das ist die eigentliche Frage nach der Philosophie. Im Kommunikationssystem Darwinscher Primaten und deren Nachfolger erübrigt sie sich. Wenn die Philosophie etwas taugt, müßte sie mich dazu fähig machen, die Grundworte des Menschen so zu sagen, daß auch andere sie hören und mit mir über das Gemeinte ohne offenes oder verstecktes Mißtrauen reden können. Philosophie wäre dann
Seite 17:
vor allem die Kunst, etwas mir bekannt Scheinendes für andere verständlich zu sagen.
Hiermit ist ein Unterschied zwischen zwei Weisen des Sprechens und Denkens behauptet. Wenn wir die zweite Philosophie genannt haben, so wollen wir nun die erste als "Theologie" bezeichnen und damit einen ersten Schritt auf die Lösung des Problems hin versuchen, das wir im vorigen Abschnitt an einem alten Text herausgestellt haben. "Theologie" nennen wir hier - in einem vorläufigen und noch sehr ungenauen Sinn - die Weise, in der wir unmittelbar über die Grundvoraussetzungen menschenwürdiger Existenz denken und spreChen, so wie wir sie - aufgrund geschichtlicher Bedingtheiten, vielleicht auch wirklich freier Entscheidungen "spontan" verstehen. Wir könnten, etwas moderner, auch den Ausdruck "Ideologie" dafür wählen. Doch dieser hat einen negativen Beigeschmack, den wir hier nicht intendieren. Es geht uns hier nur um den Charakter der Unmittelbarkeit, in der wir unseren "Glauben" -unsere Grundposition in Sachen Humanität - formulieren, wenn wir noch nicht darauf reflektieren, daß da auch andere sind, die nicht zu unserer "Gemeinde" zählen.
Auf dieser Ebene des Denkens und Sprechens gibt es eine Vielzahl von "Sprachspielen", von relativ in sich geschlossenen "Welten", in denen sich jeweils eine kleinere oder größere Gruppe von Menschen über die wichtigsten Dinge des Menschen ähnlich effektiv verständigt wie ein Bienenschwarm über seine internen Angelegenheiten. Beim Aufeinandertreffen der einen Sprachgruppe auf die andere gibt es nun Schwierigkeiten, die sich letztlich nur dann über den Gebrauch des Sprechens und Denkens selbst bewältigen lassen, wenn man eine andere Ebene der Kommunikation findet, die von allen gemeinsam akzeptiert und verstanden wird. Diese Kommunikationsebene nennen wir Philosophie.
Die in der Skizze gewählten "Sprachgruppen" A, B, C sind natürlich alles andere als homogen, sondern in sich
Seite 18:
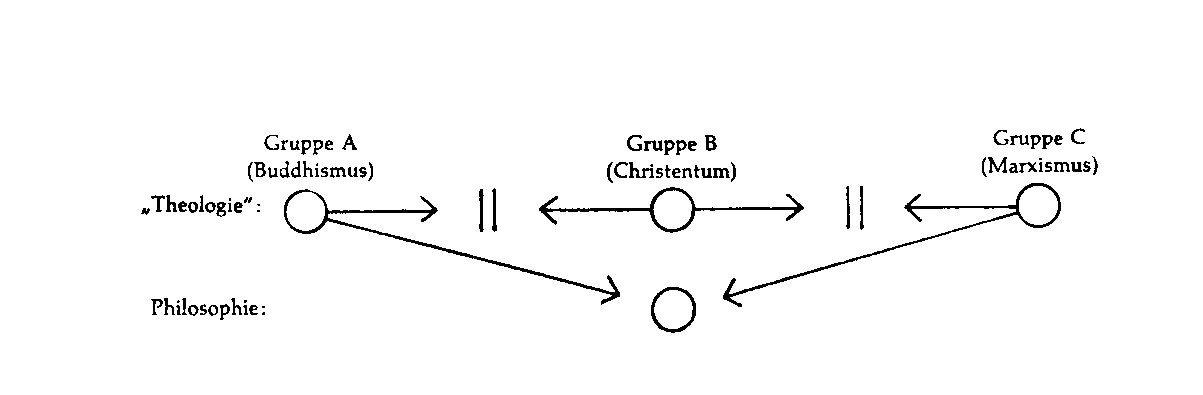
eher wieder die Ansammlung recht verschiedener Bienenstöcke (um in dem oben genannten Beispiel für unmittelbare Kommunikation zu bleiben). Aber sie sind doch einigermaßen repräsentativ in Hinsicht auf die große Kluft, die bei dem Gebrauch von Grundworten zwischen verschiedenen Denkwelten aufreißen kann. Auf der Ebene unmittelbaren Denkens und Sprechens, der "Theologie", läßt sich über solche Grundworte zwischen diesen Gruppen kaum Verständigung erzielen. Dazu müßte sich erst eine andere Sphäre der Kommunikation, die der Philosophie, finden, in der die Grundworte auf allgemeinverständliche Grundbegriffe hin durchdacht werden.
So wünschbar eine solche philosophische Kommunikationsebene ist; über ihre grundsätzlichen Möglichkeiten und Grenzen müssen wir uns noch Gedanken machen. Zunächst wird es dabei um die Frage gehen, wie man überhaupt aus der "Theologie" zur Philosophie hin, von einem Reden aus dem unmittelbaren Überzeugtsein über die wichtigsten Sachen des Menschen zu einem auch anderen verstehbaren Denken und Sprechen darüber, aufbrechen kann.
Eine wichtige Vorbedingung dafür ist nun sicher das Bewußtsein, daß tatsächlich eine solche Differenz zwischen "Theologie" und Philosophie besteht; daß man nicht schon unbedingt allgemeinverständlich spricht, wenn man meint, über die allgemeingültigsten Dinge zu reden. Hier gibt es nun das merkwürdige Phänomen, daß nicht nur Theologen im strengen Sinn dieses Worts, also etwa auf ihre Dogmatik eingeschworene Christen, sondern gerade auch solche "Theologen" (in der von uns gewählten Bedeutung), die mit Theologie (im strengen Sinn) nichts mehr zu tun haben wollen, äußerst anfällig
Seite 19:
für das Vergessen der genannten Differenz sind. Wenn gewisse Marxisten etwa sich ihrer Methodik als der allein "wissenschaftlichen" rühmen, so bewegen sie sich damit noch lange nicht auf der Ebene dessen, was wir hier als Philosophie bezeichnet haben. Sie tun sich im Gegenteil gerade sehr schwer, diese Ebene überhaupt als eine noch ausstehende Möglichkeit für ihr Denken wahrzunehmen.
Von dieser Perspektive her fällt nun ein erster Schimmer von Plausibilität auf das Unternehmen Anselms in seinem "Proslogion". Eine ausdrückliche Besinnung auf das Zentrum seiner "Theologie" ist für jeden, der Philosophie betreiben möchte, nicht etwa nur akzidentell oder gar schädlich. Es ist vielmehr nötig, daß bei der Suche nach einer allgemeinen Ebene menschlicher Kommunikation sehr deutlich das Bewußtsein des je eigenen, persönlichen Engagements an dieselbe grundlegende Sache für den Menschen wach bleibt, über die man nun mit Andersdenkenden reden will. Sonst geraten immer wieder Momente, die zum unmittelbaren, spontanen Engagement gehören, leicht auf die Seite dessen, was man für Philosophie hält. Die Weise, wie Anselm sich an die Sache der Philosophie macht, gibt wenigstens eine Gewähr: Er weiß, daß er sich hier auf einen neuen, nicht selbstverständlichen Weg begeben muß, und daß es für diese Reise wichtig ist zunächst einmal den Ort des ihm Selbstverständlichen genau zu markieren, um dann auch wirklich aufbrechen zu können und sich nicht unbemerkt doch nur innerhalb der vertrauten Mauern zu bewegen.
Seite 20:
überhaupt, nur um das Philosophische an solchem Fragen geht?
Philosophie hat es, wenn sie nicht doch letztlich eine verkappte "Theologie" - in welcher Gestalt auch immer - sein soll, mit dem eigentlich Eigenständigen des Menschen zu tun; mit dem, was er als ihm ursprünglich zugehörige Möglichkeit behaupten kann, wenn alle Fremdbestimmungen, alle Vorbelastetheit durch biologisches Erbgut, repressive Umwelt, sprachliche Vorbedingungen allgemein von ihm abgefallen sind. Ob es überhaupt einen solchen autonomen Urbesitz eigener Möglichkeiten des Menschen gibt, ist eine andere Frage; ob - wenn ja - der Mensch je rein davon Gebrauch zu machen vermag, eine weitere. Aber Philosophie muß auf diesen Gebrauch eigener Kräfte zielen, sonst ist sie ihren Namen nicht wert.
Die großen, "klassischen" Zeiten der Philosophie - von Platon bis hin zu Kant und den auf ihm fußenden Denkern des sogenannten "deutschen Idealismus" waren optimistisch zumindest im Hinblick auf die erstgenannte Frage nach einem ursprünglichen "Vermögen" der Vernunft an Allgemeingültigem und darum auch allen Menschen unverlierbar Eigenem, so sehr sie auch um die Schwierigkeiten wußten, dieses Vermögen zu nutzen. Wir Heutigen sind skeptischer, was eine solche Autonomie und universale Gültigkeit "der Vernunft" angeht.
Es lohnt sich aber wenigstens ein kurzer Blick auf die Wegscheide, wo jener alte Optimismus an einen solchen Gipfel gelangte, daß es danach nur noch die verschiedensten Möglichkeiten zu geben schien, den gesamten früheren Weg als Sackgasse zu erkennen: die Behauptung vom "absoluten Ich". Mit dieser Formel hatte J. G. Fichte den Ruf der Aufklärung und schließlich Kants zur Vollendung bringen wollen, niemand solle einen anderen Gesetzgeber als die freie und sittliche Vernunft über sich dulden und so im eigenen Willen die universale Gültigkeit der Vernunft geltend machen
Seite 21:
Weniger bekannt ist allerdings, an welche Vorbedingung nach Fichte die Realisierung dieses "absoluten Ichs" im Individuum geknüpft ist. Er wies auf, daß keiner sich selbst als freies, menschliches Ich auch nur zu erkennen, geschweige denn, seine Freiheit zu realisieren vermag, ohne vorgängig von einem anderen als ein selbständiges Individuum angerufen und anerkannt worden zu sein (12).
Wir wollen hier nicht näher auf Fichte eingehen. In groben Zügen zumindest ist der Kern jenes von ihm vorgetragenen Gedankens uns allen vertraut. Seiner selbst bewußt werden und zu einer freien Person entfalten kann sich der Mensch nur über die Hinwendung eines anderen Menschen zu ihm. Erst darüber, daß mich ein anderer als Du anspricht oder, ursprünglicher noch, in Freude über einen neuen Menschen anlächelt, gewinne ich überhaupt ein Bild dessen, was ich bin und sein kann. Ohne diese Anerkennung durch eine "feste Bezugsperson" kommt der Mensch nicht zu sich selbst.
Nun ist auch jene zwischenmenschlich ermöglichte Selbstfindung nicht ohne Problematik. Wie wir besonders seit S. Freud wissen, vermittelt die erste Bezugsperson dem jungen Menschen nicht nur das Glück eines ursprünglichen Wissens um sich selbst. Mit dem Spiegel seines eigenen, von anderen anerkannten Seins, den sie dem Kind in ihrem Lächeln vorhält, impft sie ihm zugleich die typischen Erwartungen und Fehlhaltungen einer bestimmten Generation und Gesellschaft ein. Ist die erste "Bezugsperson" zu "fest", dann hat der Herangewachsene später alle Mühe, auf der Couch des Psychiaters hinter seine Neurosen zu kommen und mit seinem "Über-Ich" fertig zu werden.
Gerade das höchst Eigene, die grundlegende Möglichkeit, meiner Freiheit bewußt zu sein und davon Gebrauch zu machen, ist also in äußerstem Maße von dem Willen und Verhalten anderer abhängig. Nur wo mir von anderen Raum für mein Eigenes freigegeben wird, da vermag ich es aus mir herauszubringen. Es hört durch diese Abhängigkeit von anderen nicht auf, mein
Seite 22:
Selbstbesitz zu sein, sondern kommt so überhaupt erst zutage. Aber in dieser ständigen Angewiesenheit auf anderen Willen, anderes Denken, andere Sprache bleibt es auch stets bedroht.
Das dauernde Risiko dieser Bedrohtheit macht es schließlich auch so schwierig, ganz vor sich selbst zu kommen in jenem Zusammenspiel von größter Abhängigkeit und größter Freiheit, das wir noch immer mit dem Wort Liebe bezeichnen - wenn wir auch unter demselben Titel eben wegen des genannten Risikos viele Surrogate erfunden haben, uns darum herumzudrücken. Wo Liebe mir wirklich geschieht, da entdecke ich ureigene Fähigkeiten, die mir sonst verborgen blieben; da zerbrechen Krusten und Zäune, die vorher verhinderten, mich ganz kennenzulernen.
Vorher mag ich mir mancherlei Gedanken über meine Autonomie und Persönlichkeit machen. Ich werde kaum je darauf kommen, den freien und mir gänzlich unverfügbaren Akt eines anderen für die Spitze meines eigenen Selbstbesitzes zu halten. Eher werde ich mich in Lebensentwürfen einrichten, in denen ich möglichst wenig von dieser Zufälligkeit abhängig bin. Aus Sorge, solche immer verfügbare Sicherheit zu verlieren, werde ich im gegebenen Fall vielleicht sogar lieber auf eine wirkliche, mich bis ins Letzte meinende Zuwendung des anderen verzichten, als mich der damit notwendig verbundenen Umorientierung auszusetzen.
Wenn die Frage nach der Möglichkeit von Philosophie als Betätigung meiner ureigenen Vernunft in eine solche Richtung führt, dann wird auch das "Proslogion" Anselms, seine "Anrede" als Rahmen einer philosophischen Reflexion, den er nicht davon gelöst wissen will, uns nicht ganz so unverständlich erscheinen. Gewiß, Anselm spricht hier noch vom Standpunkt seines unmittelbaren Engagements, den er klar zu unterscheiden weiß von der Philosophie, seiner Bemühung im Gespräch mit Andersdenkenden. Er spricht noch seinen Gott an, der dann radikal in die Frage gestellt werden muß. Aber die Weise, wie er es tut, bringt doch einiges
Seite 23:
von dem zur Sprache, was in der Philosophie zu bedenken ist, soll sie nicht völlig mißlingen.
Er spricht (im ersten Kapitel) von dem "Bilde" Gottes, das tun soll, wozu es gemacht ist". Das ist, in theologischer Sprache, das Wissen um einen Grundbestand menschlichen Vermögens, den es in der Philosophie zu aktivieren gilt. Doch dieses Bild sei so "abgenutzt" und "rauchgeschwärzt" durch menschliches Versagen, daß es ebendas, was es eigentlich können müßte, nicht vermag, wenn Gott nicht erneuert, lehrt, sich zeigt (13).
So fremdartig heutigem Philosophieren diese Art von ,Anrede" sein mag - und, in dem Anselm eigenen Gebetsstil, auch dem heutigen Theologen erscheint -: Hier ist doch ein Bewußtsein jener Verschränkung von Vernunftautonomie und Abhängigkeit wach, das in der Zeit von Rationalismus und "Aufklärung" fast völlig abhanden kam und erst in den letzten hundert Jahren unter dem Titel "Hermeneutik" mühselig an die Oberfläche kommt. Es wir zwar, beim heutigen philosophischen Fragen nach Gott nicht zuletzt zu klären sein, ob nicht ein bestimmtes Verständnis von Gott selbst und der sich im Gebet zu ihm (und nur wenig zur Welt) kehrenden Seele beigetragen hat zu einem solch verkürzten Autonomiebegriff, dem schließlich auch die Möglichkeit schwand, nach Gott zu fragen. Die Richtung der "Anrede" Anselms aber, das Ausgespanntsein der Vernunft auf ein unverfügbares Du, das schließlich nur in seiner rückhaltlosen Zuwendung meiner eigenen Freiheit Raum gibt, wird voll im Auge bleiben müssen, nicht nur bei der Frage nach Gott, sondern bei jeglicher Beschäftigung mit der Philosophie, damit sie nicht von Grund auf mißrät.
Seite 24:
zu bringen. Das Schwierigste an diesen beiden Bewegungen schien dabei der Aufbruch selbst zu sein- einmal der Schritt vom Unmittelbar-Selbstverständlichen zur Allgemeinverständlichkeit, der nur über eine ehrliche Besinnung auf das Eigentümliche der persönlichen Grundposition möglich wird; zum anderen der Blick auf die mir vorausliegende Freiheit des anderen - auf menschliche Umwelt, Sprache, Anerkennung - in der die eigene Vernunft erst zu sich selbst kommt.
Nun erscheinen, gerade von diesen in ihrer ganzen Dynamik vollzogenen Bewegungen her, die beiden Grundbedingungen der Philosophie selbst noch einmal in einem unlöslichen Widerspruch. Hat nicht immer wieder die Forderung nach Allgemeingültigkeit dazu verführt, den Zusammenhang zwischen der je eigenen Autonomie und ihren geschichtlich-mitmenschlichen Voraussetzungen zu verkennen? Leistet die Philosophie nicht in der Theorie dem Vorschub, was dann in politischer Praxis zur Beglückung aller bei Unterdrückung der Minderheiten, und das heißt doch letztlich: der Keimzellen freien Zusammenlebens geschieht? Kommt dieses Mißverständnis von wahrer Kommunikation nicht auch in jener Skizze zum Ausdruck, die wir oben (1.2) zur Kennzeichnung des Verhältnisses von "Theologie" und Philosophie benutzten?
Der wirkliche Dialog mit dem Andersdenkenden wird doch nicht über die Herstellung von Universalbegriffen geleistet, über Leerformeln, die - wie deklarierte Menschenrechte oder eine offiziell eingesetzte Herrschaft des Volks - zwar von allen ohne weiteres akzeptiert, aber ebenso leicht mißbraucht werden können. Er vollzieht sich doch nicht, indem man die geschichtlich bedingten Mauern zwischen den Gruppen A, B, C ... einfach auf sich beruhen läßt und jenseits aller konkreten Konfrontation nach abstrakten Schemata der Übereinstimmung sucht.
Das berechtigte Ziel der Philosophie, aus den unmittelbaren Selbstverständlichkeiten heraus zur Kommunikation [Kommunika-
Seite 25:
tion] mit Andersdenkenden zu kommen, scheint geradezu nur unter Aufgabe der hochtrabenden Forderung nach allgemeingültigen Begriffen erreichbar zu sein. Es kann je nur um die Annäherung einer sehr begrenzten Anzahl von Dialogpartnern und der Sprachwelten gehen, welchen sie zugehören, nicht um das allseitige Erlernen von Esperanto. So wünschbar es ist, daß der Horizont gegenseitigen Verstehens sich in diesem Annäherungsprozeß ständig erweitert: Erklärt man erst einmal die universale Kommunikation zum letzten Maßstab, so ist man schon dabei, den je anstehenden Dialog zu überspringen - wie die modernen Massenmedien, die, indem sie sich an alle wenden, kaum jemand mehr in wesentlichen Dimensionen seiner Existenz berühren. Zur weltweiten Bewältigung technischer Probleme mag schließlich eine allgemeinverständliche Informationssprache nützlich und nötig sein. Diese stellt aber nicht das Ziel des Philosophierens dar, dem es um grundlegende Bereiche der Frage nach dem Menschen geht, Bereiche, die durch die technische Verfügung eher bedroht als gefördert werden.
Doch war eigentlich jene moderne Version von Universalität gemeint, wenn in der Philosophiegeschichte nach "Universalien" gefragt wurde? Vor Argumenten, die unmittelbar einleuchten, muß man besonders auf der Hut sein. Wir finden uns heute allzuleicht bereit, die philosophische Suche nach allgemeingültigen Begriffen aufzugeben, wie überhaupt alles, was nach Absolutem, Letztverbindlichem und Unbedingtem klingt. Wenn es in der zwischenmenschlichen Kommunikation nur um eine jeweilig sehr begrenzte Möglichkeit gegenseitiger Annäherung geht und die unterschiedlichen geschichtlichen Bedingungen immer bloß relativ übersteigbar sind auf ein gemeinsames Sinnverständnis hin, dann hält sich auch das Interesse, das ich für den anderen jeweils aufzubringen vermag, im Relativen und Vorläufigen. Nie werde ich ernsthaft bis auf den Grund seiner Existenz dringen wollen, nie wird er mich daher auch selbst "radikal", bis an die Wurzel meiner eigenen Substanz,
Seite 26:
einfordern können, wenn es da kein Letztes und Unbedingtes gibt, das zu erreichen wäre.
So viel behutsamer und toleranter unser Zugehen auf andere auch aussehen mag, wenn wir die Rigorismen sittlicher Absolutheitsansprüche und die Universalismen einer umspannenden Vernunft von uns abgestreift haben: Gleitet schließlich diese Behutsamkeit und Toleranz nicht in eine wohlwollende Jovialität ab, die weit hinter dem humanen Engagement zurückbleibt, zu dem ein Sokrates, Platon oder Kant fähig waren? Wenn es da keine Botschaft von letztgültigem Sinn mehr zu erwarten gibt, mit dem ein anderer an uns herantreten könnte, muß dann nicht auch unser Hinhören überhaupt an Schärfe verlieren? Bleibt der letzte Grund, aus dem die einzelnen leben und handeln, prinzipiell im Dunkeln, läßt er sich grundsätzlich nicht in einen Gedanken fassen, den alle verstehen könnten, dann wird sich das gemeinsame Gespräch schnell auf jene Oberflächlichkeiten einspielen, die sich ohne größere Mühe aufdecken lassen.
Es ist berechtigt, wenn besonders wir Deutschen wie gebrannte Kinder die hohen Ideale und großen Allgemeinverbindlichkeiten scheuen. Sobald aber die Frage nach einem unbedingten, alle verbindenden Sinn völlig verstummt, dann beginnt sich auch im bestgemeinten Dialog jene Wand eines fundamentalen Desinteresses aufzurichten, das die notwendige Folge eines ins Unbegreifbare entgleitenden letzten Grundes alles Denkens und Sprechens ist. Diesen gemeinsamen Grund allen menschlichen Sagens nicht isoliert für sich, sondern an der Wurzel unserer je konkreten Anrede, unseres Bezugs zur wirklichen Welt aufzudecken, wird die schwierigste Aufgabe der Philosophie sein. Wo diese aber die Forderung nach universaler Gültigkeit ihrer Begriffe fallenläßt, gibt sie auch jene vornehmsten Ziele menschlicher Kommunikation preis, die nur sie zu hüten imstande ist.
Haben wir mit diesem Plädoyer für die Philosophie als letzter Garantin der Möglichkeiten von Humanität aber
Seite 27:
nicht den Boden verlassen, auf dem die hier zu interpretierende Rede Anselms steht? Wozu bedarf es dann noch einer von der göttlichen Offenbarung lebenden Theologie, wenn es im letzten doch nur um Philosophie geht? Wird hier die Philosophie, wenn schon "Magd der Theologie", nicht doch zu einer solchen "Dienerin" erklärt, die der "gnädigen Frau" die Fackel voranund nicht nur die Schleppe nachträgt (14)?
Im Blick auf christliche Theologie, und insbesondere auf das Denken Anselms selbst braucht uns diese Frage nicht zu beunruhigen. Von dorther ergibt sich nicht nur, was wir im vorigen Abschnitt (1.3) zu zeigen versuchten, daß die Autonomie der eigenen Vernunft ihrer Verwiesenheit auf ein sie befreiendes Wort nicht widerspricht, sondern eigene Vernunft erst in der freien Zuwendung eines anderen zu sich selbst kommt.
Christlichem Glauben zufolge muß sich Theologie sogar notwendig in Philosophie übersetzen. Dies einmal wegen der Gleichheit des "ersten" und des "zweiten Gebots", Gott und den Nächsten zu lieben. Wo Liebe bei der Hinwendung zum anderen vor seinem radikalen und skeptischen Fragen Halt macht, da ist sie nicht mehr Liebe zu dem Gott, der vor nichts Menschlichem zurückschreckt, selbst nicht vor der abgründigen Dunkelheit des Chaos, in das Bosheit den Menschen zu bringen vermag. Philosophie in diesem Sinn eines wirklich vorbehaltlosen Eingehens auf den ganz andersgearteten Menschen, eines Denkens und Redens in seiner Sprache, steht in der Konsequenz des Gehorsams dessen, der nicht glaubte, sein Gottgleichsein wie ein Beutestück festhalten zu müssen (15).
Der andere Grund liegt in der Endgültigkeit, dem "Ein-fiir-allemal", in dem sich Gott christlichem Glauben zufolge dem Menschen gezeigt hat. Bin ich als Glaubender wirklich restlos von dieser Endgültigkeit überzeugt, mit der mir Gott begegnet ist, so darf ich solches Überzeugtsein nicht als Fremdbestimmung, als "bloßen Glauben" festhalten wollen. Hat mich diese Wahrheit bis ins Mark meines Selbst getroffen, dann muß ich
Seite 28:
auch das ganze Eigene meiner Vernunft, all meine menschlich-philosophische Autonomie davon durchdringen lassen.
In dem lateinischen (und in vielen modernen Sprachen beibehaltenen) Ausdruck für Überzeugen, "con-vincere" (wörtlich: besiegen"), klingt noch etwas von dem Kampf und Sieg über die Vernunft mit, um die es bei solchem Durchdringen einer Überzeugung geht; auch etwas von jenem Schauplatz rationaler Anspannung, aus dem in der Geschichte des christlichen Abendlandes das Ifides quaerens intellectum" ("der Glaube, der das vernünftige Einsehen sucht") - so lautete der ursprüngliche Titel von Anselms "Proslogion" - entsprang. Das eigene Selbst ist nur dann wirklich bis in seine geheimsten Tiefen von der Endgültigkeit einer gesehenen oder gehörten Wahrheit überzeugt, wenn es ehrlich sagen kann, daß ihm nie und nimmer etwas anderes zu begegnen vermag, das diese Wahrheit überholte. Dies kann es aber nicht, solange die Wahrheit eine nur einfach hingenommene, gehorsam geglaubte und allein darum festgehaltene bleibt. Erst wenn die Vernunft in eigener Autonomie den Begriff einer endgültigen Wahrheit und eines letzten Sinns für den Menschen gefaßt hat, so daß nichts ihr diesen Begriff mehr zu zerstören vermag, kann sie ehrlich sagen, daß sie bis ins letzte von der erfahrenen Wahrheit besiegt ist, insofern diese nämlich den philosophisch nicht mehr auflösbaren Begriff von letztem Sinn erfüllt.
Die Frage der Philosophie nach einem Begriff von letztgültigem Sinn, die wir als ihre wichtigste Aufgabe herausgestellt haben, als ein ihr notwendiges Ziel, will sie sich nicht jovial an den Brennpunkten des menschlichen Dialogs vorbeidrücken, gehört auch ins Zentrum christlicher Theologie. Mag die Theologie auch manchmal ängstlicher dieser autonom von der Philosophie zu bewältigenden Aufgabe gegenübergestanden haben, als ihr dies von der Mitte ihres Auftrags her gestattet ist; bei Anselm zumindest ist nichts von solch ängstlicher Sorge zu spüren.
Seite 75:
1 "Nachdem ich - auf zwingende Bitten einiger Mitbrüder hin - ein Schriftchen als Beispiel dafür, wie man über den Grund des Glaubens nachsinnt, in der Rolle eines, der still mit sich überlegend nachdem forscht, was er nicht weiß, herausgegeben hatte, bedachte ich, wie dieses durch Verkettung vieler Beweise verflochten sei, und begann bei mir zu fragen, ob sich nicht ein Argument finden ließe, das keines anderen bedürfte, um sich zu beweisen, als seiner allein, und das allein hinreichte, um zu stützen, daß Gott in Wahrheit existiert und daß er das höchste Gut ist, das keines anderen bedarf und dessen alles bedarf, um zu sein und sich wohl zu befinden, und was immer wir von der göttlichen Wesenheit glauben." (Postquam opusculum quoddam velut exemplum meditandi de ratione fidei cogentibus me precibus quorundam fratrum in persona alicuius tacite secum ratiocinando quae nesciat investigantis edidi: considerans illud esse multorum concatenatione contextum argumentorum, coepi mecum quaerere, si forte posset inveniri unum argumentum, quod nullo alio ad se probandum quam se solo indigeret, et solum ad astruendum quia deus vere est, et quia est summum bonum nulio alio indigens, et quo omnia indigent ut sint et ut bene sint, et quaecumque de divina credimus substantia, sufficeret.), Proslogion. Untersuchungen, Lat.-dtsche Ausg. v. F. S. Schmitt, StuttgartBad Cannstatt 1962, Vorwort, 5. 69 (Opera omnia, Vol. I, p. 93).
2 Summa theologica, pars I, qu. 2, art. 3, corp.
3 Vgl. die Übersichten und kritischen Auseinandersetzungen bei F. 5. Schmitt, Proslogion, a.a.O., S. 3--52; The Many-faced Argument, ed. by J. Hick and A. C. McGill, New York 1957; J. McIntyre, St. Anselm and His Critics. A Re-Interpretation of the Cur Deus Homo, Edinburgh-London 1954, pp. 1-55. McIntyre's eigene Ansicht: "The firmness of the belief is reached only through the lengthy process of the intellectus, ebd., p. 22, dürfte allerdings auch kaum mit Anselms Position zu vereinbaren sein.
Seite 76:
44 K. Barth, Fides quaerens intellectum. Anselms Beweis de Existenz Gottes im Zusammenhang seines theologische Programms, Zürich 31958, bes. S. 60.
5 Vgl. ebd., 5. 35 ff.
6 "Si quis unam naturam ... aliaque perplura quae de de( sive de eius creatura necessarie credimus, aut non audiendo aut non credendo ignorat: puto quia ea ipsa ex magna parte, si vel mediocris ingenil est, potest ipse sibi saltem sola ratione persuadere", Opera omnia, Vol. 1 p. 13.
7 S. bes. in der Vorrede zum "Cur deus homo": "Und schließlich, mit Beiseitesetzung Christi, so, als ob niemals etwas von ihm gewesen wäre, beweist (das erste Büchlein) mit zwingenden Gründen, daß es unmöglich sei, daß ein Mensch ohne ihn gerettet werde" (Ac tandem remoto Christo, quasi numquam aliquid fuerit de illo, probat rationibus necessariis esse impossibile ullum hominem salvari sine illo)., in der Übersetzung von F. S. Schmitt, 5. 3 (Opera omnia, Vol. II, p. 42); vgl. ebd., S. 11, 13, 15 (Opera omnia, Vol. II, pp. 47, 48, 50), Epistola de Incarnatione Verbi, nr. 1; 6 (Opera omnia, Vol. II, pp. 6-8, 20), Brief an Bischof Fulco von Beauvais (Ep. 136, Opera omnia, Vol. III, p. 280).
8 Vgl. die ähnliche Rücksichtnahme Anselms im "Cur deus homo", 1, 1: "... so schwierig (diese Frage) bei ihrer Ergründung scheint - in der Lösung (ist sie) jedoch allen verständlich ... Und weil das, was mittels Frage und Antwort erforscht wird, vielen, und namentlich langsameren Geistern, besser einleuchtet und deshalb mehr zusagt ... (et licet in quaerendo valde videatur difficilis, in solvendo tamen omnibus est intelligibilis ... Et quoniam ea quae per interrogationem et responsionem investigantur, multis et maxime tardioribus ingeniis magis patent et ideo plus placent ... ), in der Übers. v. F. S. Schmitt, S. 11 (Opera omnia, vol. II, p. 48).
9 "... Spekulation und Gebet ineinander verwoben. Das erste Element ist dem Ziel und der Zeit nach das Ursprüngliche, das andere wurde diesem gleichsam aufgepflanzt und mit ihm zu einem organischen Ganzen verwoben", Proslogion, a.a.O., S. 33.
10 Vgl. den jeweiligen Abschluß der fünf Wege" in der "Summa theologica" 1, 2, 3c
11 Zur engeren Zusammengehörigkeit von Kap. 2 und 3 des "Proslogion" s. u., S. 42.
12 Textnachweis und Literatur in: H. Verweyen, Recht und Sittlichkeit in J. G. Fichtes Gesellschaftslehre, Freiburg-München 1975, S. 90 f.
Seite 77:
13 "Ich bekenne, Herr, und sage Dank, daß Du in mir dieses ,Dein Bild' geschaffen hast, damit ich, Deiner mich erinnernd, Dich denke, Dich liebe. Aber so sehr ist es durch abnützende Laster zerstört, so sehr ist es durch den Rauch der Sünden geschwärzt, daß es nicht tun kann, wozu es gemacht ist, wenn Du es nicht erneuerst und wiederherstellst.' (Fateor, domine, et gratias ago, quia creasti in me hanc imaginem tuam, ut tui memor te cogitem, te amem. Sed sic est abolita attritione vitiorum, sic est offuscata fumo peccatorum, ut non possit facere ad quod facta est, nisi tu renoves et reformes eam), Proslogion, Kap. 1, a.a.O., S. 83 (Opera omnia, Vol. I, p. 100).
14 Vgl. I. Kant, Der Streit der Fakultäten, A 26.
15 Vgl. Phil 2,6 und unsere Ausführungen in: Ontologische Voraussetzungen des Glaubensaktes. Zur transzendentalen Frage nach der Möglichkeit von Offenbarung, Düsseldorf 1969, S. 23 ff.