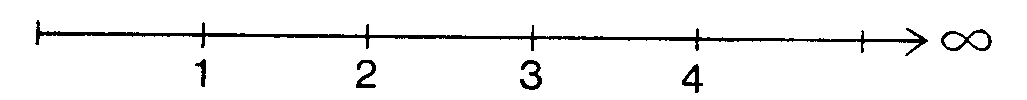
Studenten, die ich bei der Diskussion des "Proslogions" fragte, welchen Begriff sie zur Bestimmung des Wesens Gottes vorziehen würden, eine direkte Definition "das Größte" (o. ä.) - oder Anselms komplizierte Umschreibung über das Denken, wählten zumeist die erstere. Hier käme Gott nämlich in seinem wirklichen Sein in den Blick, während bei Anselm fraglich bliebe, ob er nicht im Bannkreis einer bloß gedanklichen Konstruktion verharrt.
Anselm hat seinen indirekten Begriff im "Proslogion" aber mit Bedacht an die Stelle einer direkten, "ontischen Definition des Wesens Gottes gesetzt, wie er sie selbst noch im Monologion" verwandte. Dort hatte er zur Bezeichnung Gottes von einem "höchst Guten" bzw. "höchst Großem" gesprochen, von "etwas, das das Größte und Beste ist, das heißt das Höchste von allem, was ist". Nun aber, kaum zwei Jahre später, antwortet er seinem Kritiker Gaunilo, der bei der Wiedergabe seines Arguments den Begriff "größer als alles" (maius oninium) benutzte -also eine Formulierung, die grundsätzlich auf der Linie der im "Monologion" von Anselm selbst gewählten Bestimmungen lag -, daß damit der Kein seines Gedankens mißverstanden sei. Denn auf der Grundlage eines solchen Begriffs, der das größte
Seite 48:
Seiende ausdrückt, ließe sich das entscheidende Argument für die Existenz Gottes und die einzigartige Qualität seines Seins nicht ohne weiteres durchführen: Was nämlich, wenn jemand sagt, es existiere etwas, das größer ist als alles, was ist, und trotzdem ließe sich dieses als nichtexistierend denken, und: etwas Größeres als dieses ließe sich, auch wenn es nicht tatsächlich existiere, dennoch denken?
Anselm war sich der Einzigartigkeit seines Gedankens durchaus bewußt. Sie liegt in der Einsicht, daß die eigentliche Gefahr bei unserem Fragen nach Gott nicht von den Dingen der Welt, nicht einmal dem gewaltigen Universum in seiner Gesamtheit her droht, sondern von unserem Denken selbst. Mit Anselms Begriff "ist der Feind (die Verneinung bzw. der Zweifel) in seinem eigenen Lager aufgesucht, das Denken selbst, von dem her bei Voraussetzung eines ontischen Gottesbegriffs die Erkenntnis Gottes immer wieder in Frage zu stellen ist, unter das Zeichen des Namens Gottes gestellt und damit zu notwendiger Erkenntnis Gottes aufgerufen". Der Tragweite dieser Einsicht, die uns über das unmittelbare Anliegen des "ontologischen Gottesbeweises" hinaus mitten in die Aktualität der modernen Gottesfrage verweist, müssen wir nun genauer nachgehen.
(1) ... Also kommt man mit Notwendigkeit zu einem Erstbewegenden, das von keinem bewegt wird. Und dies erkennen alle als Gott.
(2) ... Also muß man eine erste Wirkursache annehmen, die alle Gott nennen.
(3) ... Also muß man etwas annehmen, das durch sich selbst notwendig ist ... Und das nennen alle Gott.
Seite 49:
(4) ... Also gibt es etwas, das allen Wesen Ursache ihres
Seins, ihres Gutseins und jedweder Vollkommenheit
ist. Und dies nennen wir Gott.
(5) ... Also gibt es ein Geistwesen, von dem alle Naturdinge auf ihr Ziel hingeordnet werden. Und das nennen wir Gott.
Worin kommen alle diese Begriffe überein? Das können wir uns vielleicht am besten an einem einfachen Beispiel aus der Mathematik deutlich machen, an der Menge der natürlichen Zahlen:
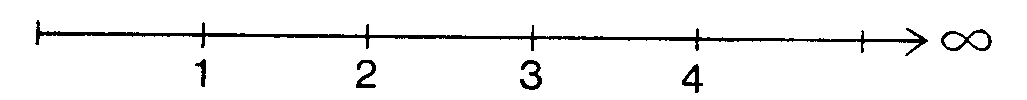
Man kann diese Reihe, diesen Zahlenstrahl als "potentiell unendlich" bezeichnen. D. h.: wir vermögen immer weiter zu zählen, aber nicht die Reihe zu einem Abschluß zu bringen. Sie läuft "ins Unendliche", ins Unvollendbare fort.
Die genannten "ontischen" Bestimmungen Gottes, "via eminentiae", versuchen nun alle, Gott, anhebend von einer Wirklichkeit der Welt oder einer besonderen Qualität (wie Groß-, Gut-, Vollkommensein), als jenes Letzte, "Absolute" zu definieren, das die Vernunft im Durchgang durch alles Seiende nicht zu ereichen vermag. Wenn K. Barth diesen Versuchen vorhält, sie würden Gott als die "Spitze einer Pyramide" sehen "Ohne die übrige Pyramide könnte die Spitze auch nicht Spitze sein" - so tut er ihnen Unrecht. Ein Thomas von Aquin etwa weiß sehr gut, daß die Erstursache nicht in der Verlängerung von bloßen "lnstrumental"- oder weitervermittelnden Ursachen, sondern als etwas diesen gegenüber ganz anderes anzusetzen ist.
Charakteristisch für diese Begriffe ist aber, daß bei dem Versuch, Gott im Übersteigen alles Seienden und jeder endlichen Vollkommenheit zu denken, sich die Vernunft selbst in ihrem Tun nicht bedenkt. Ob sie, die dieses Übersteigen vornimmt, selbst auch mit allem anderen überstiegen ist oder sich vielmehr davon ausnehmen darf, das ist in jenen Gottesbegriffen noch nicht ausgemacht. Im Horizont mittelalterlichen Fragens ergab sich von dieser Frage her kein eigentliches Problem. Der Mensch
Seite 50:
verstand sich hier "mit Leib und Seele", all seine möglichen Denkleistungen einbegriffen, als Teil des von Gott geschaffenen Universums, wußte sich eingeborgen in der göttlichen Vernunft, aus der alles Sein und alle endliche Vernunft hervorging.
Spätestens seit dem Auslaufen des Mittelalters begannen aber weitreichende Ereignisse dieses scheinbar selbstverständliche Bewußtsein der Geborgenheit zu erschüttern. Wir wollen zwei besonders markante Erfahrungen herausgreifen: die Verbreitung der Fest um die Mitte des 14. Jahrhunderts und das abendländische Schisma im letzten Viertel des 14. bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts.
Im Gegensatz zu heute waren Epidemien im Mittelalter zwar keine Ausnahmezustände. Die Beulenpest, die, aus dem Orient eingeschleppt, sich um die Mitte des 14. Jahrhunderts in ganz Europa ausbreitete, sprengte aber auch den mittelalterlichen Erfahrungshorizont, der mit der Anwesenheit des Dämonischen neben dem Göttlichen in der Welt nur zu vertraut war. Am schlimmsten wütete die Pest in den Städten. Siena verlor drei Viertel bis vier Fünftel der Gesamtbevölkerung, Hamburg 50-66 %, Bremen 60-70 %. Insgesamt wurden in der Zeit von 1348 bis 1375 in Frankreich mindestens 30 %, in England sogar mindestens 40 % der Menschen durch die Seuche hinweggerafft. Wo sonst dem mittelalterlichen Menschen die Welt Ort der Begegnung mit seinem Schöpfer schien, auf dessen Spuren er allüberall stieß, stand er nun dem nackten Grauen gegenüber.
Schon häufiger hatte es im Mittelalter Papst und Gegenpapst und damit die Schwierigkeit gegeben festzustellen, von wo die kirchlichen Belange - und damals auch die der Gesellschaft überhaupt - mit letzter Autorität entschieden wurden. Das vermochte man im allgemeinen aber ebensogut mit dem Glauben an letztgültig verkündigte Wahrheit zu vereinbaren wie die Krankheiten und Seuchen mit dem Glauben an den in der Natur gegenwärtigen Schöpfergott. Das große abendländische Schisma hingegen war eine Krise innerhalb der Ordnung
Seite 51:
menschlichen Zusammenlebens, die der Pest, welche um etwa dieselbe Zeit auf dem Felde der Natur wütete, durchaus vergleichbar war. Wenn noch heute Kirchengeschichtler nicht in der Lage sind zu entscheiden, wer seit 1378 gültig an der Spitze der Kirche stand - der Papst in Rom oder der in Avignon, wozu 1409 noch ein offenbar ebenso gültig vom Konzil von Pisa eingesetzter dritter Papst kam -, dann kann man verstehen, me schnell die Verwirrung in einer Zeit, in der Europa auch politisch voller unbewältigter Widersprüche war, um sich griff. (Da) jeder Papst die Anhänger des Gegners bannte und niemand unbeteiligt bleiben konnte, befand sich faktisch die ganze Christenheit im Banne. Der Riß zog sich durch alle Länder, Diözesen und Pfarreien hindurch ... und führte die Kirche in die schwerste Verfassungskrise, die sie je erlebt hat".
Wie wirkten sich solche Erschütterungen der Geborgenheit des Menschen in einem von Gott getragenen und geordneten Universum schließlich auf die Frage nach Gott selbst aus?
B. Pascal hat das Grundgefühl des neuzeitlichen Menschen schön in seinen "Pensées" ausgedrückt:
Der Mensch ist nur ein Schilfrohr, das zerbrechlichste in der Welt, aber ein Schilfrohr, das denkt. Es ist nicht nötig, daß das ganze All sich rüste, um ihn zu vernichten: ein Windhauch, ein Tropfen Wasser reichen hin, ihn zu töten. Aber, wenn das All ihn vernichten würde, so wäre der Mensch doch edler als das, was ihn zerstört. Denn er weiß, daß er stirbt und er kennt die Übermacht des Weitlls über ihn. Das All aber weiß nichts davon.
Hier sind die "fünf Wege", mit denen der Mensch nach Thomas aus dem Geschaffenen in der Welt auf Gott hinfand, völlig in den Hintergrund getreten. Statt im vertrauten Umgang mit den Dingen den Schöpfer selbst zu erspüren, sieht sich nun der Mensch eher von einem feindlichen Universum umlauert oder doch wenigstens einer Übermacht der Natur gegenüber, die seine Frage nach Sinn ins Leere gehen läßt.
Ganz ähnlich schlägt sich dieses Grundgefühl bei Descartes, dem "Vater der Moderne", nieder. Er vermag
Seite 52:
erst dadurch festen Halt in der Wirklichkeit zu gewinnen, daß er alles einem universalen Zweifel unterzieht. Nur weil der Akt des Zweifelns, das "Ich denke" selbst, sich nicht mehr in möglichen Schein auflösen läßt; nur weil mit dem "Ich denke" zugleich die Gewißheit eines "Ich bin" unzertrennlich verknüpft ist, findet dieser Philosoph schließlich festen Boden unter den Füßen, von dem aus er dann - über einen Gottesbeweis methodisch gesicherte Prinzipien für wissenschaftliches Erkennen gewinnen kann.
Descartes geht aber noch einen Schritt weiter, bis nahe an den neuzeitlichen Atheismus heran. Um sich auch gegen den letzten Zweifel zu sichern, entwirft er über allen konkreten Zweifel hinaus noch die Hypothese eines allmächtigen Lügengeistes, der dem Menschen unzerstörbar scheinende Evidenzen - wie etwa die mathematischen Wahrheiten - vielleicht nur zum Schein vorgaukelt, ein Tyrann der absoluten Vernunft, der mit dem menschlichen Denken vielleicht nur ein grausam absurdes Spiel treibt.
Selbst gegen einen solchen Genius der Lüge wäre aber das "Ich denke / Ich bin" noch gefeit-.
Aber woher weiß ich denn, daß es nichts anderes als alles bereits Aufgezählte gibt, an dem zu zweifeln auch nicht der geringste Anlaß vorliegt? Gibt es etwa einen Gott, oder wie ich den sonst nennen mag, der mir diese Vorstellungen einflößt? ... Aber es gibt einen, ich weiß nicht welchen, allmächtigen und höchst verschlagenen Betrüger, der mich geflissentlich stets täuscht. - Nun, wenn er mich täuscht, so ist es also unzweifelhaft, daß ich bin. Er täusche mich, soviel er kann, niemals wird er doch fertigbringen, daß ich nichts bin, solange ich denke, daß ich etwas sei.
Hier geht Descartes über das, was er im Hinblick auf sein Ausgangsargument bei Augustinus lernen konnte, weit hinaus, geht aber auch noch weiter als Pascal. Es schlägt sich bei ihm die doppelte Erfahrung nieder, die wir oben kurz skizzierten, nicht nur die der Pest im Bereich der Natur, sondern auch die der gänzlichen Verwirrung auf dem Feld zwischenmenschlich kommunizierter Wahrheit. Anstelle der letzten Geborgenheit des
Seite 53:
Menschen in der Schöpfung und schließlich in der alles durchwaltenden göttlichen Vernunft tritt hier, für einen Augenblick und versuchsweise wenigstens, die Möglichkeit in den Blick, daß die menschliche Kraft der Vernunft ganz allein auf sich gestellt ist und sich vielleicht sogar gegen all jene geistigen Mächte durchsetzen muß, die man vordem im Glauben mit Gott verband.
Von hierher ist es nur noch ein kleiner Schritt bis zu dem Gespräch zwischen "Orest" und "Jupiter" in J. P. Sartres "Fliegen":
Jupiter: Orest! Ich habe dich geschaffen, und ich habe alle Dinge geschaffen ... Du bist hier nicht bei dir zu Hause, Eindringling; du bist in der Welt ... wie ein Wilderer im herrschaftlichen Wald; denn die Welt ist gut ...
Orest: Aber du hättest mich nicht frei erschaffen sollen ... Ich habe Mühe, mich zu begreifen. Gestern noch warst du ein Schleier über meinen Augen, ein Wachstropfen in meinen Ohren; gestern hatte ich noch eine Entschuldigung für mein Dasein, denn du hattest mich in die Welt gesetzt, um deinen Plänen zu dienen, und die Welt war eine alte Kupplerin, die mir unaufhörlich von dir sprach. Und dann hast du mich verlassen ... Plötzlich ist die Freiheit auf mich herabgestürzt, und ich erstarrte, die Natur tat einen Sprung zurück, und ich hatte kein Alter mehr, und ich habe mich ganz allein gefühlt, inmitten deiner kleinen, harmlosen Welt, wie einer, der seinen Schatten verloren hat, und es war nichts mehr am Himmel, weder Gut noch Böse, noch irgendeiner, um mir Befehle zu geben.
Jupiter: Nun und? Soll ich das Schaf bewundern, das die Räude von seiner Herde trennt? ... Siehe, ein unmenschliches Übel nagt an dir, das meiner Natur fremd ist, dir selber fremd. Kehre zurück Ich bin das Vergessen, ich bin die Ruhe.
Orest: Mir selber fremd, ich weiß. Außerhalb der Natur, gegen die Natur, ohne Entschuldigung, ohne andere Entschuldigung, ohne andere Zuflucht als zu mir selbst. Aber ich werde nicht unter dein Gesetz zurückkehren: ich bin dazu verurteilt, kein anderes Gesetz zu haben als mein eigenes ... Was habe ich mit dir zu tun, oder du mit mir? Wir werden aneinander vorübergleiten wie zwei Schiffe auf einem Fluß, ohne einander zu berühren. Du bist Gott, und ich bin frei ...
Seite 54:
Blicken wir von hier auf den Typus von Gottesbegriffen zurück, den wir zu Ausgang dieses Abschnittes betrachtet haben. Dort ist Gott zwar als das Höchste und Äußerste des Seins gefaßt, das der Mensch zu denken vermag. Aber das Denken selbst das sich hier das Absolute gegenübersetzt, bleibt in diesem Begreifen außerhalb des absoluten Seins - so, daß es notfalls auch an ihm vorbeigleiten kann, wie ein Schiff am anderen.
Es besteht zwar die Möglichkeit, in einem zweiten Akt des Nachdenkens festzustellen, daß ja auch das menschliche Denken unter die Endlichkeiten und Bedingtheiten fällt und darum vom Absoluten umfangen ist. Dann muß sich das Denken aber irgendwie nach Art des von ihm auf Gott hin überstiegenen Seienden auffassen und bleibt damit hinter seiner eigentlichen Würde zurück, die ihm ja gerade jenen Überstieg über alles Seiende möglich machte. Doktor Faustus mag sein unaufhaltbares Forteilen von einer Gegebenheit zur anderen als Not empfinden. Er weiß darin zugleich aber seinen ganzen Adel, der ihm selbst einen Pakt mit dem Teufel erlaubt: Nirgends wird man den Menschen in endgültiger Befriedigung über irgendeinem seiner Objekte antreffen.
Not und Adel des Menschen liegen in jener "potentiellen Unendlichkeit", in dem Unvollendbaren der Reise, aber auch dem Bewußtsein, daß kein Seiendes, keine "Zahl" auf dem ins Unendliche fortlaufenden Strahl, dem Anspruch der Vernunft genügt, sondern immer noch ein "plus 1" zu jedem "n" hinzu, eine neue Größe über jede denkbare Größe hinaus gedacht werden kann.
Wenn diese trotz aller Bedingtheit und Not bestehende Würde der menschlichen Freiheit nicht genügend geachtet wird, dann entwindet sich das Denken immer wieder dem Zugriff des Absoluten, und sei das philosophische System, in dem Gott und die Welt gedacht wird, auch noch so imponierend. Descartes' "Ich denke/Ich bin" aufgreifend, hat Sartre sagen können: "diese Theorie
Seite 55:
ist die einzige, die dem Menschen eine Würde verleiht, die einzige, die ihn nicht zum Gegenstand macht".
Die Schwäche der ontischen Gottesbegriffe vom "Größten", "Höchsten' usw. liegt darin, daß hier nur eine Aussage über Gott in bezug auf alles Seiende, nicht aber auf das Denken selbst gemacht wird. Schließt sich das Denken nachträglich in das überstiegene Seiende mit ein, so bedenkt es nicht seinen Unterschied zur Gesamtheit dessen, was es sich zum Gegenstand machen kann, ohne selbst doch je ganz darin aufzugehen. Das Lob Gottes hat auf diese Weise etwas von der Frömmigkeit jener an sich, die meinen, sich selbst möglichst niedrig ansehen zu müssen, damit ihnen Gott nur recht groß vorkomme. Im Gegenzug, wenn das Denken sich seiner Besonderheit gegenüber "dem AB" bewußt wird, gerät Gott selbst leicht in Mißkredit. Er scheint in einer unauflösbaren Konkurrenz mit der menschlichen Freiheit zu stehen, da doch offenbar beider Wesen und Würde im Übersteigen von allem Gegebenen beruht. "Entweder ist Gott, oder ich bin frei". Bestenfalls gleiten beide Unendlichkeiten ungerührt aneinander vorüber. jedes Gebot, das vom Höchsten" und "Größten" an den Menschen erginge - der doch selbst fähig ist, denkend alles zu übersteigen -, müßte als eine Beschränkung seiner Freiheitsrechte aufgefaßt werden. Sartre kann sich den Schöpfer nur nach Art eines Handwerkers vorstellen, der den Menschen wie ein technisches Werkzeug zu bestimmten Zwecken in die Welt setzt.
Läßt sich nicht eine Weise des Nachdenkens über Gott und zugleich die menschliche Vernunft selbst finden, die jenem Dilemma entgeht?
Seite 56:
mit dem Bewußtsein menschlicher Freiheit fast unausweichlich in Konflikt geraten mußte. Um so erstaunlicher, daß ein halbes Jahrtausend vor ihm Anselm der "Vater der Scholastik" - einen Gottesbegriff prägte, der auch mit den höchsten Vorstellungen des Menschen über seine eigene Würde in Einklang steht.
"Id quo maius cogitari non potest", "das, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann": Hier wird das Denken eigentlich gar nicht zugunsten eines Höheren oder Höchsten verlassen, sondern es bleibt bewußt bei sich, indem es etwas Bestimmtes zu denken sucht. Orest braucht sich nicht wie ein Wilderer im Garten Gottes oder wie ein räudiges Schaf seiner Herde vorzukommen, indem er dieses "etwas" denkt.
K. Barth hat Unrecht, wenn er hier von einem "Verbot" an das Denken spricht. Wer das göttliche Verbot für das Zentrale im Paradiese hält, ist schon dabei, es zu überschreiten. In der Mitte des Gartens stand der "Baum des Lebens" - ohne jedes Verbot (Gen. 2, 9). Als die Frau auf die listige Frage der Schlange hin statt dessen den mit einem Verbot belegten Baum ins Zentrum rückt (vgl. Gen. 3, 3 mit 2, 17), ist sie schon auf dem Weg der Lüge begriffen.
Wer diese biblische Geschichte von "ursprünglicheren" Mythen her interpretiert, in denen der Neid der Götter, nicht die unendliche Freigebigkeit Gottes im Vordergrund stand, hat nicht mehr weit bis zu E. Bloch, für den die Schlange der eigentliche Beglücker der Menschheit darstellt.
Diese Schlange ist die Kraft, die Moses zur Seite stand, der Stab, der sich in eine Schlange verwandelte ... Diese allumfassende Schlange ist der weise Logos der Eva ... Sie ist der, der in den letzten Tagen in Gestalt eines Menschen erschien zu Zeiten des Herodes ... Niemand kann daher errettet werden und wieder aufsteigen ohne den Sohn, welcher ist die Schlange ... Sein Ebenbild war die eherne Schlange in der Wüste, die Moses errichtete; das ist der Sinn des Wortes (Joh. 3, 14): 'Und wie Moses in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muß der Menschensohn erhöht werden'; ... was durch ihn gemacht ist, ist Leben.
Seite 57:
Mit diesem Zitat schließt sich der Verfasser des "Prinzips Hoffnung' der Meinung der Ophiten, einer gnostischen Sekte des dritten Jahrhunderts, an: "die wirkliche Ursünde wäre es gerade gewesen, nicht sein zu wollen wie Gott".
Kehren wir zu Anselm zurück. Es ist schon erstaunlich, daß gerade er, der sein philosophisches Gespräch mit einer Anrede" Gottes einleitet, die vom Bewußtsein der ganzen Niedertracht des Menschen und ihrer Folgen bebt, dem Atheisten einen Gottesbegriff als Diskussionsgrundlage anbietet, in dem dieser seine Vernunft nicht zu verstecken braucht. Er darf bei seinem Eigenen bleiben, wird zu nichts anderem gezwungen.
Und doch enthält der Begriff Anselms ein "Nein" für das Denken. Ein freies, nicht von außen auferlegtes Nein zwar, das aber gerade deshalb um so weniger überhörbar ist. Der Mensch kann etwas denken, worüber hinaus nichts gedacht werden kann. Er braucht hierbei nicht - wie bei ontischen Begriffen vom "Größten" seine eigene Tätigkeit zu beschneiden oder auch nur zu vergessen. Im Begriff Anselms bleibt bewußt, daß der Strahl des Denkens - 1, 2, 3 usf. ins Unendliche über alles wirklich oder auch nur möglicherweise gegebene Größte hinausführt. Kein Seiendes ist größer als das Denken, das alles Seiende denkt. Zu allem Seienden kann es ein "plus 1" denken.
Zugleich aber wird hier die Not des Menschen greifbar, die seiner unendlichen Würde - die schließlich doch nur eine Unvollendbarkeit ist - anhaftet. All sein unendliches Sehnen ist, wie Hegel sagt, nur eine "schlechte Unendlichkeit". Das Äußerste seiner Möglichkeiten besteht darin, den Adel von Unendlichkeit ohne diesen Beigeschmack von Not zu denken, ein "etwas-, das unendlich ist, ohne weiterlaufen zu müssen. Dieses "etwas" - das "nicht plus 1" -liegt gewiß nicht auf dem Strahl der "natürlichen Zahlen". Es ist kein Seiendes, das sich je vom Denken zum Objekt machen ließe. Es ist aber auch nicht nur die unendliche Möglichkeit des Denkens, alles zu übersteigen - eine Möglichkeit [Möglichk-
Seite 58:
keit], die doch zugleich immer ein Kampf des Hasen mit dem Igel bleibt. Es ist die Würde der Unendlichkeit ganz ohne Hast und Not - nicht "fertig" und banal (wie die Frau des Igels: "Ick bün all hier!"), vielmehr in einer souveränen Gelassenheit, die das Denken zu einem Ausruhen und Aufatmen einlädt, das keine verlorene Wette mit Mephisto bedeuten würde.
Das Erstaunliche des Anselmschen Gottesbegriffs ist, daß hier Gott und dem Menschen volles Recht geschieht. Wollte man im Rückgriff auf die Tradition der "negativen Theologie" und Mystik einwerfen, Gott sei doch eigentlich der völlig Undenkbare, Unbegreifbare; auch Anselm mache sich noch jenes Übergriffs in die Rechte Gottes schuldig, der unausweichlich mit jedem Versuch verbunden ist, ihn überhaupt zu denken: Selbst auf diesen Einwand weiß das "Proslogion" Antwort. Sein fünfzehntes Kapitel lautet kurz und bündig:
Herr, Du bist also nicht nur, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, sondern etwas Größeres, als gedacht werden kann. Weil nämlich etwas derartiges gedacht werden kann: wenn Du es nicht selbst bist, kann etwas Größeres als Du gedacht werden; was nicht geschehen kann.
Weder von der Theologie noch von der Philosophie her läßt sich dieser Begriff aus den Angeln heben. Er verkürzt nichts an dem, was immer der Glaube über seinen Gott erfahren mag. Er unterdrückt aber auch keine Möglichkeiten des Menschen. Allerdings schützt er das Denken vor möglichen Ausflüchten, sich mit etwas als dem eigenen Äußersten des Menschen zufriedenzugeben, das weniger wäre als der wirkliche Begriff Gottes. Dies gilt es nun, im Abheben von einigen neuzeitlichen Karikaturen eines Gottesbegriffs, noch etwas deutlicher zu machen.
David Hume, der Empirist und wahre Vater unseres heutigen Denkens, glaubte das Entstehen der Gottesidee (wie alles Gedachte) aus einer sekundären Aktion unseres Verstandes auf der (allein entscheidenden) Grundlage unserer Sinneseindrücke erklären zu können
Seite 59:
Die Vorstellung Gottes im Sinne eines allwissenden, allweisen und allgütigen Wesens entsteht aus der Besinnung auf die Vorgänge in unserem eigenen Geiste und aus der Steigerung dieser Eigenschaften der Güte und Weisheit ins Grenzenlose.
So unglaublich primitiv diese Aussage einem jeden klingt, der sich einmal auf den Gedanken Anselms eingelassen hat; man soll ihre Wirkkraft nicht unterschätzen. Jedesmal etwa, wenn ich mit amerikanischen Studenten ein halbes Jahr lang über die Gottesfrage diskutiert hatte, blieb mir der Eindruck, das Gros meiner Hörer glaube noch immer eher an die Existenz von fliegenden Untertassen oder anderen "Unidentified Flying Objects", als daß es für möglich hielt, zu einem Gottesbegriff zu gelangen, der nicht einfach bloße Fortsetzung unserer Sinnestätigkeit mit anderen Mitteln wäre.
Auch die unsere letzten Jahrhunderte berückenden kritischen Aussagen über die Religion - von Feuerbach und Marx bis zu Freud und ihren jüngsten Nachfolgern - operieren ja im Grunde (bei aller berechtigten Destruktion von Mißgestaltungen, die die Religion hervorgebracht hat) mit demselben "Gottesbegriff", wie ihn Hume verwendet. Ob der Gottesgedanke nun als die Projektion unserer Wünsche in ein Jenseits oder als die Rache eines verdrängten Sexualtriebs "erklärt' wird, stets dominiert hier die Vorstellung, dieser "Begriff" ergebe sich aus dem bloßen Fortlaufen am Zahlenstrahl (1, 2, 3 usf. ins Unendliche). Auf solchen Wegen ist aber noch nicht einmal die Möglichkeit dieses unseres von Gegebenheiten nicht aufhaltbaren Fortlaufens erklärt. Wie sollen empirische Gegebenheiten etwas Aie das Denken produzieren, das sich aber auch mit nichts Gegebenem oder Gebbarem abspeisen läßt? Wie aber soll erst aus den "dialektischen Sprüngen" der Materie oder dem psychischen Triebmaterial jener Gedanke eines wirklich im Denken Begriffenen und dennoch vom Denken unendlich Verschiedenen hervorgehen, wie ihn Anselm erfaßt?
Bedenken wir gleichsam zur Probe ein anderes Beispiel
Seite 60:
aus der Mathematik, das als scheinbar äußerster Gegensatz zum Anselmschen Begriff in Wirklichkeit eine wichtige Ergänzung dazu darstellt (damit wir Gott nicht nur im Himmel und unter den Großen suchen): den mathematischen Punkt. Er stellt (auf der mathematischen Ebene) ebenso den Grenzgedanken beim Versuch der unendlichen Teilung bzw. Verkleinerung eines Gegebenen dar, wie Anselms Begriff (auf der philosophischen Ebene, d. h. im Unterschied zur Mathematik auch noch den Denkakt miterfassend) den Grenzgedanken beim Weg ins unendlich Große ausdrückt. Ebensowenig wie "das, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann", identisch ist mit der bloß potentiellen Unendlichkeit, d. h. Unvollendbarkeit der natürlichen Zahlen, ist das mit dem "mathematischen Punkt' Anvisierte der potentiell unendlichen Teilbarkeit eines Gegebenen gleichzusetzen. Schon beide "potentiellen Unendlichkeiten" - mathematischer Abdruck der Würde des Denkens auf ein absolut Großes bzw. eine absolute Einfachheit hin - lassen sich nicht aus empirischen Ursachen erklären. Von dem Versuch etwa, eine Pfeilspitze sehr spitz zu machen, gibt es keinen empirisch zu motivierenden Übergang zu dem absurden Bemühen, eine absolute Einheit zu denken. Aus der Welt lassen sich nur Steine und Gipfel, nicht aber der Versuch des Sisyphus erklären, den Stein auf dem Gipfel festzuhalten. Dazu bedarf es, wie der Mythos weiß, des Fluchs von oben.
Der Gedanke des "mathematischen Punktes", der einfach souverän in sich ruhenden Einheit ("worüber hinaus Einfacheres nicht gedacht werden kann"), ist - wie "auf der anderen Seite" Anselms Gottesbegriff von der potentiellen Unendlichkeit des Denkens - vom Gedanken der unendlichen Teilbarkeit eines Gegebenen aber noch einmal unendlich abgehoben. Er läßt sich erst recht nicht aus empirischen Vorgaben erklären. Denkt man ihn aber als Begriff absoluter Einfachheit, dann weiß man, woher all die potentiell unendlichen Bemühungen des Menschen, zu einer einfachsten Einheit zu finden,
Seite 61:
herrühren: Nicht die Beobachtung von immer kleineren oder feineren Größen in der Natur führt zum Begriff des schlechthin Einfachen. Er selbst ist vielmehr die treibende Kraft in unserer Vernunft, daß wir eine Reihe von immer feineren "Punkten" auf den mathematischen Punkt hin zulaufen lassen.
Hier bleibt wirklich Platon im Recht, daß unsere Wahrnehmungen und Vorstellungen nur die Schatten der eigentlichen Ideen sind, niemals aber deren Erklärungsgrund abgeben können. So skandalös es uns Heutigen auch klingen mag: der Gottesbegriff Anselms ist durch keine geschichtliche Vorgegebenheit zu erklären. Er steht absolut einfach in sich. Es ist zwar nicht ausgemacht, wann und ob je der Gesprächspartner Anselms sich zur Höhe dieses Gedankens erheben wird. Wenn er ihn aber denkt, dann weiß er sich ebenso auf den unauflösbaren Boden seiner eigenen, durch nichts im Universum umzustoßenden Freiheit gestellt wie über dieses Eigene hinaus zu einem unendlich Anderen getragen, welches, ohne das Eigene des Denkens zu zerstören, all seine Grenzen sprengt.
Im "Proslogion" verdichtet sich alles zu äußerster Präzision. Auch das Beispiel vom Maler ist keineswegs beiläufig. Das erkennt man schon, wenn man aufmerksam
Seite 62:
das "Monologion" liest, wo "Bild" der zentrale Begriff der theologisch-philosophischen Systematik ist und das Beispiel von "Proslogion", Kap. 2, fast wörtlich vorweggenommen wird - "... gleichwie der Künstler vorher im Geiste empfängt, was er nachher dem Entwurf seines Geistes gemäß im Werke verwirklicht".
Man kann sich dessen aber auch noch einmal bei der Lektüre des "Cur Deus homo", des "Warum Gott Mensch geworden" vergewissern. Auch hier wird nur scheinbar leicht dahingesagt, was in Wirklichkeit den ganzen Gedanken trägt. Im Dialog mit dem Mönch Boso zögert Anselm anfänglich, überhaupt an die Christologie heranzugehen:
Auch das hält mich sehr von deiner Bitte zurück, daß der Gegenstand nicht allein kostbar ist, sondern, wie er ja von dem Schönsten an Gestalt unter den Menschenkindern" handelt, so auch an innerem Gehalt schön ist über die Fassungskraft der Menschen. Daher fürchte ich, es möchte - wie ich gewöhnlich über stümperhafte Maler ungehalten bin, wenn ich den Herrn selber in häßlicher Gestalt gemalt sehe - auch mir so widerfahren, wenn ich mich unterfange, einen so schönen Gegenstand in kunstloser und verächtlicher Darstellung zu verarbeiten.
Das ist nicht nur Reflexion eines Ästheten (obwohl auch das!), der noch keine Gelegenheit hatte, die herrlichen Darstellungen des Gekreuzigten, wie sie nur wenige Jahre zuvor besonders im Kölner Raum geschaffen wurden (etwa das Gerokreuz vom Kölner Dom oder den Crucifixus von St. Georg) mit Mißgeburten aus viel späteren Jahrhunderten zu vergleichen. Hier schwingt viel tiefer noch die Sorge des Beters im "Proslogion" mit:
Ich bekenne, Herr, und sage Dank, daß Du in mir dieses "Dein Bild" geschaffen hast, damit ich, Deiner mich erinnernd, Dich denke, Dich liebe. Aber so sehr ist es durch abnützende Laster zerstört, so sehr ist es durch den Rauch der Sünden geschwärzt, daß es nicht tun kann, wozu es gemacht ist, wenn Du es nicht erneuerst und wiederherstellst.
Dies wird einige Kapitel später im "Cur Deus homo" selbst deutlich. Anselm läßt (durch den Schüler, nicht den Lehrer selbst!) die Argumente der Tradition, die er
Seite 63:
(zu Ende des dritten Kapitels) kurz resumiert hatte, als Gemälde bezeichnen, welche dem Ungläubigen wie auf Wolken gemalt vorkommen. Für sie - die Bilder eines historischen Faktums - muß zunächst ein fester Grund dadurch gelegt werden, daß man innerhalb der Struktur der Vernunft selbst die notwendige Sinnfrage, das unausweichliche Angelegtsein auf die Antwort aufweist, die Christus dem Glauben nach gebracht hat.
Der Gedanke ist überall der gleiche, hier, im "Monologion" und im "Proslogion' bei der Frage nach Gott und seinem Verhältnis zu dem von ihm Geschaffenen, wie später im "Cur Deus homo" bei der Frage nach der Notwendigkeit der Menschwerdung Gottes: Das Bild Gottes soll tun, wozu es geschaffen ist - Gott in sich nachbilden. Und dies ist kein von außen dem Menschen auferlegtes Gebot, sondern innerste Möglichkeit der sich ganz "emanzipierenden Freiheit". Wenn der Mensch sich selbst aufzeichnet, ohne sich dabei einen Zerrspiegel vorzuhalten, so muß notwendig sichtbar werden, daß er Bild Gottes ist. Anselms Gottesbegriff ist diese zu Ende gezogene Skizze des Menschen. Wenn er sich bis zum Äußersten denkt, nicht vorher den Griffel hinlegt, dann stößt er auf "das, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann".
Könnte gerade darin aber - so hatten wir am Ende des dritten Kapitels gefragt - nicht die letzte Absurdität des Menschen zum Ausdruck kommen: daß er zwar notwendig die wirkliche Existenz Gottes denkt, wenn er nur dessen Begriff denkt - ja, wie wir jetzt hinzufügen dürfen: wenn er nur sich selbst richtig denkt -, daß damit aber noch nicht ausgemacht ist, ob diese Notwendigkeit des Denkens in einem wirklichen Sein gründet, das dies alles birgt?
Sisyphus mag zwar sich selbst und sein zwischen Gipfel und Abgrund gespanntes Geschick nicht anders begreifen können: er muß es auf einen göttlichen Ruf oder auch Fluch zurückführen. Darin allein mag auch seine ganze Würde bestehen. Das hebt aber nichts von seiner Not. Er bleibt Sisyphus, dessen unausweichlicher
Seite 64:
Spruch "Gott ist" im Echo der Steine, Gipfel und Abgründe wie Hohn klingt.
Anselm vermag den Ruf des Menschen nach Sinn vielleicht aufs Äußerste zuzuspitzen. Trägt er auch etwas zu seiner Klärung bei? Dieser Frage wollen wir uns abschließend in zwei Schritten zuwenden: indem wir zusehen, (1) ob - über das ontologische Argument hinaus - Anselms Gottesbegriff nicht doch so etwas wie einen Beweis der Existenz Gottes in sich trägt, (2) ob und inwiefern ein solcher Beweis bei der philosophischen Frage nach einem letzten Sinn weiterhilft.
Descartes geht dort, fassen wir die wesentlichsten Schritte zusammen, wie folgt vor:
(1) Auch noch im universalsten Zweifel hat das Denken mit dem "Ich denke/ Ich bin" einen festen Boden der Wirklichkeit.
(2) In das Denken fallen nun die verschiedenartigsten
Begriffe - wie etwa Tier, Mensch, Engel, Gott.
(3) Aufgrund des methodischen Zweifels ist die wirkliche Existenz (realitas actualis sive formahs) all
Seite 65:
dieser Wesen zwar in Frage gestellt. Sie habe indem sie einen je spezifischen Gegenstand bezeichnen, dennoch eine genau bestimmte Existenz in unserer Vernunft (realitas obiectiva).
(4) Der Satz vom Grund bzw. das Kausalprinzip verlangt nicht nur, daß für wirklich existierende Dinge eine zureichende Ursache angegeben wird. Auch die je verschiedenen Inhalte unseres Denkens, auch die bloßen Begriffe von Tier, Mensch usw. müssen auf eine Ursache zurückgeführt werden, die hinreichend ihr Zustandekommen erklärt. (Beispiel: Auf einem Film habe ich einmal Bilder von Dingen aufgenommen, die jetzt nicht mehr in der Wirklichkeit existieren. Auch die bloßen Bilder auf dem Film - in meiner Vernunft - verlangen aber nach einer zureichenden Erklärung, wie sie entstehen konnten.)
(5) Vorstellungen von Tieren oder Menschen kann ich mir relativ beliebig bilden, wenn ich nur je einmal in der Erfahrung einem wirklichen Tier oder Menschen begegnet bin. Fabelwesen wie den Pegasus kann ich ersinnen, indem ich Vorstellungen von Vierbeinern und Vögeln nehme und wie in einer Fotomontage zusammensetze. Auch den Begriff eines Engels mag ich auf diese Weise wohl zustande bringen, wenn mir nur die Begriffe "Mensch" und "Gott" gegeben sind.
(6) Nur die Idee "Gott" kann durch nichts anderes in meiner Vernunft zustandekommen als durch eine wirkliche Einwirkung des wirklich existierenden Gottes selbst.
Der Beweisgang der dritten Meditation ist im einzelnen recht unübersichtlich. Man hat vor allem eingewendet, mit welcher Notwendigkeit der Begriff "Gott" in unserer Vernunft angetroffen wird, und ob das hier vorausgesetzte Kausalprinzip bzw. der Satz vom Grund eine unbedingt von selbst einsichtige Prämisse ist.Descartes hat aber selbst darauf verwiesen, daß schon die bloße Möglichkeit des Zweifelns die Existenz der Gottesidee
Seite 66:
in uns voraussetzt. Die hier zum Austrag kommende Radikalität des Suchens ist ohne die innere Triebkraft einer Idee absoluter Wahrheit nicht zu erklären. Von hierher, der gleichsam angeborenen" Suche nach dem Grund bzw. nach der letzten Erklärung des inneren Widerspruchs, in dem sich die Vernunft befindet, wird auch der Satz vom Grund" ("Nichts ist ohne zureichenden Grund') verständlich; er wird nicht erst nachträglich in einen Gottesbeweis' eingeführt. Wie könnte jene innerste Triebkraft des Ich denke" aber weniger wirklich sein als die unbezweifelbare Wirklichkeit des "Ich denke" selbst!
Dies ist nun auch, was die Dynamik des Anselmschen Gottesbegriffs mit der dritten Cartesischen Meditation verbindet. Wenn sich die Vernunft selbst als unbezweifelbar wirklich und die Idee Gottes als ihre tiefste und eigentlich treibende Kraft erfaßt, dann muß sie sich selbst in dieser Bewegung auf die wirkliche Existenz Gottes als den sie allein erklärenden Grund zurückführen. Das ist dann kein "ontologisches" Argument mehr, kein unzulässiger Schritt vom bloß gedachten zum wirklichen Sein, sondern Schritt innerhalb einer Wirklichkeit, die ihre eigene Struktur enthüllt.
Seite 67:
Folgen wir damit auch dem Urteil Anselms, daß der Atheist tatsächlich ein "Tor" sei? Zunächst ist zu bemerken, daß diese Kennzeichnung des Atheisten als "Toren" außerhalb des genannten Bibelzitats sich erst am Ende des "Gottesbeweises" (Kap. 3) und lediglich in Form einer Frage findet. Im vierten Kapitel beschränkt sich Anselm dann darauf verständlich zu machen, wie der seinem Wesen nach so vvidersprüchliche Gedanke "Es gibt keinen Gott" dennoch möglich ist, wie jemand diesen Satz tatsächlich in seinem Herzen sprechen" kann.
Die Frage nach der "Torheit' des Atheisten stellt sich aber noch einmal verschärft, wenn richtig ist, was wir in diesem Kapitel darzustellen versucht haben. Wenn der Begriff des "worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann' nicht nur Gott, sondern unwiderlegbar auch die menschliche Vernunft selbst zur Sprache bringt, dann stellt ja jeder, der die Existenz dieses worüber hinaus...' leugnet, sich zugleich selbst ein Armutszeugnis aus: Er versteht nicht den Dynamismus seiner eigenen Wirklichkeit oder verdeckt sie sich zumindest in ihrer entscheidenden Tragweite.
Dieses harte Wort wollen wir zunächst einmal ruhig stehenlassen, zumal es ja nicht minder den Sprecher als den Angesprochenen trifft. Welche Vorstellung, die sich auch der religiöse Mensch von Gott und seiner Beziehung zum Menschen macht, müßte nicht noch einmal nach Maßgabe des Anselmschen Begriffs gereinigt werden! Aber dieses Verdikt trifft wirklich auch alles, was sich je unter dem Titel eines Atheismus zugunsten der größeren Humanität des Menschen etabliert hat. Wer das Bessere für den Menschen will und nicht wahrnimmt, daß hinter all seinem Wollen und Tun die Kraft und Würde eines Unbedingten steht, vor dem alles endliche und unendliche Bemühen des Menschen sich als vorläufig und zu kurz gegriffen entlarvt, der legt den Menschen auf Entwürfe fest, die ihn seines letzten Adels berauben. Neben dieser Verkürzung des Menschlichen, die allem Denken und Planen anhaftet, das es
Seite 68:
bestenfalls bis zur Perspektive des "Strahls der natürlichen Zahlen", der potentiellen Unendlichkeit menschlichen Übersteigens bringt, tritt aber noch ein weit Gefährlicheres in Erscheinung. Das "Bild" kann seinen Ursprung nicht völlig verleugnen. Wo der Mensch die Existenz des "worüber hinaus..." nicht wahrhaben will oder nicht auszuhalten vermag, wird sich dennoch die Wirkmächtigkeit dieses der menschlichen Vernunft immanenten Begriffs in Pseudonymen niederschlagen.
Die Absolutheitsidee ist nicht damit aus der Welt geschafft, daß man sie für eine Chimäre oder Fehlleistung der menschlichen Vernunft erklärt. Wo sie verkannt und aus dem Bewußtsein gedrängt wird, kann sie - um einen Gedanken Kants aufzugreifen - nur um so ungenierter ihren "transzendentalen Schein" entfalten. Nicht mehr adäquat, d. h. unter Einbezug der ganzen menschlichen Würde bedacht, wird sich das Absolute unbemerkt, in geschickter Tarnung irgendwo auf dem Strahl der natürlichen Zahlen selbst festsetzen und einen Tag- oder Nachttraum als äußerstes Humanum vorspiegeln, der eigentlich unter die vom Menschen zu transzendierenden Größen gehört. Je weniger sich der Mensch mit dem eigentlichen Kern alles Religiösen, mit dem feinen aber abgründigen Unterschied zwischen der Unendlichkeit menschlicher Vernunft und dem "worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann" beschäftigt und sich in jenem Grenzbereich, wo die höchsten Ideale, aber auch die größten Beirrungen der Menschheit entspringen, auskennt, desto leichter wird er Utopien oder ihren kleinbürgerlichen Ersatzbildern verfallen, die allem Fortschritt in der Geschichte des Denkens Hohn sprechen. Wie leicht aus dem Gottesleugner zugunsten einer größeren Gerechtigkeit ein Menschenmörder wird, das hat am eindrücklichsten vielleicht A. Camus in seinem "L'Homme révolté" beschrieben.
Nun ist aber auch A. Camus nie auf die Seite derer getreten, die sich zu Gott bekannten. Fällt auch er unter das harte Wort von der Unverständigkeit des Atheisten?
Seite 69:
Hier erst kommt die Gottesfrage an ihren entscheiden den Punkt. Mit manch anderem Denker der Moderne zieht Camus den Satz: "Gott existiert" gar nicht in Frage. Er stellt - wie Iwan Karamasoff, der angesichts des Leidens der Kinder sein Eintrittsbillet in den Himmel zurückgibt - nur fest, daß es besser für Gott wäre, nicht zu existieren.
... da die Weltordnung durch den Tod bestimmt wird, ist es vielleicht besser für Gott, wenn man nicht an ihn glaubt und dafür mit aller Kraft gegen den Tod ankämpft, ohne die Augen zu dem Himmel zu erheben, wo er schweigt.
Jede Kritik, die "der Religiöse" an solchem "Atheismus" übt, wird äußerst behutsam sein müssen, soll sie sich nicht des Zynismus derer schuldig machen, die sich in warmen Pantoffeln auf die Seite der Allmacht eines Gottes schleichen, der zu seiner größeren Ehre die Schlachtung von Menschen befiehlt. Es gibt auch in der Tradition, die sich auf den "Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs" zurückführt, genug von dem, worüber hinaus Größeres gedacht werden kann. Angesichts der Frage Jobs und seiner modernen Nachfolger muß das scharfe Messer des Anselmschen Gottesbegriffs zunächst immer im Lager der "Freunde Jobs" und selbstgewissen Verteidiger des althergebrachten Gottesbildes angesetzt werden.
Allerdings gerät auch die Appellation an eine größere Gerechtigkeit, als der schweigende Gott sie gibt, immer wieder - und notwendig - in die Gefahr, daß der Kerngedanke von Gerechtigkeit verkürzt wird. Im Munde von Dostojewskijs Iwan Karamasoff wie des Doktors Rieux in Camus' "Pest" wird der Satz "Gott ist", den man einfach stehenläßt, zur Farce, weil man längst schon zu einem anderen übergegangen ist, "worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann". Die Götter, die Sisyphus zu seinem absurden Werk verdammen, haben im Drama dieses Mannes keinen wirklichen Stellenwert mehr - es sei denn den einer Zielscheibe für seinen ohnmächtigen Trotz, der, entgegen aller Versicherung, daß man sich "Sisyphus als einen glücklichen
Seite 70:
Menschen" vorzustellen habe, doch wenigstens von Zeit zu Zeit ein "absolutes Ventil", nicht nur Steine und Gipfel als Adressaten braucht. Wo aber "das, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann" auf der Linie des bloß Menschlichen gesucht wird, da kommen unausweichlich die Pseudonyme des Absoluten ins Spiel, die nicht durchschauten Beirrungen, die sich aus der Verdrängung der wirklichen Frage nach Gott ergeben.
Wir können hier dem bedrückenden Aufschrei nach Sinn, wie er aus der Erfahrung des "Absurden" und letztlich des Leidens in der "Schöpfung" entspringt, nicht weiter nachgehen. Er führt in die Richtung einer anderen Frage, die Anselm nicht mehr im "Proslogion", sondern in seinem "Cur Deus homo", "Warum Gott Mensch geworden" aufgeworfen hat. In unserem Zusammenhang kommt es allein darauf an, die Frage nach Sinn in der notwendigen Schwebe zu erhalten, nicht schon dadurch abzukürzen, daß man Gott - sei es "religiös" oder latheistisdi" -unterhalb des worüber hinaus..." denkt.
Daß hier auch für den Verteidiger des gefolterten Menschen im Prozeß mit Gott eine bleibende Aufgabe liegt, dafür zum Schluß noch ein kurzer Hinweis. Wenn es bei der Frage nach dem "Boden des Arguments" darum geht, die wirkliche Position des Gesprächspartners als Basis des Dialogs zu finden (s. o. Kap. 2), dann wird man auch den Vertreter des "Protestatheismus" auf das Beste seines Engagements hin ansprechen dürfen.
In einem gewissen Sinn geht er über den Aufschrei Jobs hinaus, der ja nur einen Grund für die Berechtigung des eigenen Leidens sucht. Schon Iwan Karamasoff stellt die Frage nicht mehr für sich - "wir alle haben ja vom Apfel gegessen" -, sondern stellvertretend für den anderen, unschuldig Leidenden. Von hierher, von den ohnmächtig am Bett des von der Pest befallenen Jungen mit seinem Tode Ringenden, muß die Frage nach dem Recht des "Protestatheismus" gegenüber dem Gottesbekenntnis ausgehen.
Seite 71:
Nimmt man diese Situation der äußersten, im zwischenmenschlichen Bezug durchzustehenden Agonie des dem Tode "Geweihten" aber ganz ernst, dann ergibt sich für den mit unbezweifelbarem Recht Protestierenden eine seltsame Aporie. Bleibt er bei seinem Urteil über die Widerrechtlichkeit und absolute Sinnlosigkeit des Leidens, dann wird es einen Augenblick geben, von dem ab er den Sterbenden mit sich allein läßt. Er kann sich mit diesem und seinem Schicksal ja nur so weit identifizieren, wie der Protest selbst noch Sinn hat. Von dem Augenblick an, wo er zum anderen (wenn auch nur unausgesprochen) sagt: jetzt ist dein Kampf verloren; jetzt bist du bloßer Spielball einer Macht, die ganz ohne Sinn ist 1 hält er sich auf einem Felde zurück, wo der Kampf des Sisyphus, wenn auch absurd, so doch vielleicht nicht ganz ohne Sinn ist. Der andere ist der Sinnlosigkeit allein überlassen.
Bleibt der Verteidiger aber bis zuletzt bei seinem Mandanten, dann muß er ihm (wenn auch nur wortlos) erklären, daß er sich auf den zwar nicht einsichtigen Sinn des Leidens dennoch einläßt, daß er mitgeht auch dort, wo er nur Dunkel und Grund für den gerechtesten aller Proteste sieht. Man kann aber keinen Schritt in eine auch noch so unbestimmte Richtung tun, ohne wenigstens eine auch noch so unbestimmte Hoffnung auf Sinn in sich zu tragen. Entweder man läßt den anderen im Letzten und Äußersten seiner Not allein oder man unterschreibt blanko einen Scheck, den nur der einzulösen vermöchte, über den hinaus Größeres nicht gedacht werden kann.
Alles, was man sonst noch außer seinem eigenen Namen auf diesen Scheck schreiben mag, bleibt fragwürdig. Vor allem mit Trostworten, die sich wie selbstverständlich auf das Kreuz und die Auferstehung des fleischgewordenen Gottes beziehen, sollte man vorsichtig sein. Man gerät so leicht in die Rolle eines Besserwissers, der auf einen bekannten Fonds zurückgreift und damit den anderen doch nur wieder in seinem je einmaligen, durch keinen anderen vertretbaren Leiden zurückläßt. Stellvertreter [Stell-
Seite 72:
vertreter] kann auch Jesus nur sein, indem er in das Dunkel der scheinbar ausweglosen Gottverlassenheit betend vorangeht. Das Dunkel selbst tut sich je neu und einmalig auf.
Wer hier aber noch mitgeht, der kann trotz aller Anklage den Satz Gott ist' nicht mehr einfach auf sich beruhen lassen. Er muß auf einen existierenden Gott hin sprechen, den schweigend Unbekannten anreden, wenn er bei seinem Mandanten ausharren will; denn sein eigenes Konto ist mit diesem Schritt ebenso sicher überzogen wie mit jenem unnachahmlichen Satz, den einmal Wolfgang Borchert geschrieben hat: "Nachts schlafen die Ratten doch!"
Wer seinen eigenen Gedanken bis zu Ende durchhält, der muß "Gott ist" in einem positiven, nicht nur kalten oder bitteren Sinne sagen. Der bloße Gedanke schon führt unerbittlich in den Kontext einer Anrede, eines "Proslogion".
Seite 82:
1 "Summe bonum", "summe magnum", vgl. Kap. 1 (Opera omnia, Vol. I, p. 1,5).
2 "Aliquid ... maximum et optimum, id est summum omnium quae sunt", vgl. Kap. 2 (Opera omnia, Vol. I, p. 1.5. Weitere ähnliche Belege s. ebd. p. 102, zu Z. 3).
3 "Quid enim si quis dicat esse aliquid maius omnibus quae sunt, et idipsum tamen posse cogitarl non esse, et aliquid maius eo etiam non sit, posse tamen cogitari?", Resp. editoris [V.], Opera omnia, Vol. I, p. 135.
4 Dies schließt natürlich nicht aus, daß er zu seinem Gottesbegriff von philosophiegeschichtlich früheren FormuIierungen angeregt wurde. Vgl. die Belegstellen, die F. 5. Schmitt Opera omnia, Vol. I, p. 102, zu Z. 3, anführt, insbesondere Seneca, Natur. quaest., 1. 1, Praef.: "magnitudo ... qua nihil maius cogitari potest". Von diesem Buch gab es in der Bibliothek des Klosters zu Bec im 12. Jh. zwei Abschriften, vgl. R. W. Southern, Saint Anselm and his Biographer, Cambridge 1966, p. 59.
5 K. Barth, Fides quaerens intellectum, a.a.O., 5. 84.
6 Summa theologica I, 2, 3c.
7 Fides quaerens intellectum, a.a.O., S. 82.
8 Nach G. Tellenbach, Saeculum Weltgeschichte, Bd. V, Freiburg-Basel-Wien 1970, S. 139 f.
9 A. Franzen, Kleine Kirchengeschichte, Freiburg-Basel-Wien 1965, 5. 226.
10 Fragment 347.
11 Meditationes de prima philosophia / Meditationen über die Grundlagen der Philosophie, II (pp. 24s), hrsg. v. L. Gäbe, Hamburg 1959 (Phil. Bibl.), S. 43.
12 Vgl. De lib. arb. II 3, nr. 7; De vera rel. 39, nr. 73; De Trin. X 10, nr. 14; De civ. Dei XI 26; Solol. III.
13 Akt III, Szene 2.
14 Ist der Existentialismus ein Humanismus? in: Drei Essays, Frankfurt a. M. - Berlin 1966, 5. 25.
15 In dieser kraft Gottes Offenbarung wirklichen Relation an Gott denkend, erkennt (Anselm) sich als unter jenes Verbot gestellt, kann er nichts Größeres bzw. Besseres oberhalb Gottes denken, ohne der für den Glauben ausgeschlossenen Absurdität zu verfallen, sich selbst, indem
Seite 83:
er dieses Größere denken wollte, über Gott zu stellen." Fides quaerens intellectum, a.a.O., S. 73.
16 Aus Hippolytos, Elench. V, bei E. Bloch, Atheismus im Christentum, Reinbek b. Hamburg 1970, S. 167.
17 Ebd.
18 Die schlechte Unendlichkeit pflegt vornehmlich in der Form des Progresses des Quantitativen ins Unendliche, dies fortgehende Überfliegen der Grenze, das die Ohnmacht ist, sie aufzuheben, und der perennierende RückfaIl in dieselbe, - für etwas Erhabenes und für eine Art von Gottesdienst gehalten zu werden, sowie derselbe in der Philosophie als ein Letztes angesehen worden ist. Dieser Progreß hat vielfach zu Tiraden gedient, die als erhabne Produktionen bewundert worden sind. In der Tat aber macht diese moderne Erhabenheit nicht den Gegenstand groß, welcher vielmehr entflieht, sondern nur das Subjekt, das so große Quantitäten in sich verschlingt. Die Dürftigkeit dieser subjektiv bleibenden Erhebung, die an der Leiter des Quantitativen hinaufsteigt, tut sich selbst damit kund, daß sie in vergeblicher Arbeit dem unendlichen Ziele nicht näher zu kommen eingesteht, welches zu erreichen freilich ganz anders anzugreifen ist.' Wissenschaft der Logik, Erster Teil, a.a.O., S. 225 f.
19 Auch Hegel bleibt schließlich bei einer von innerer Not behafteten Unendlichkeit des Absoluten, worüber hinaus Größeres gedacht werden kann": Nach ihm findet das Absolute erst durch Hervorbringung der Welt zu seinem wahren Wesen.
20 Mit Recht hat A. Schurr (Die Begründung der Philosophie, a.a.O., S. 73-120) hervorgehoben, daß diese Begründung der Unbegreifbarkeit Gottes wesentlicher Bestandteil des Gottesgedankens im "Proslogion" ist.
21 Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand, Hamburg 1964 (Phil. Bibl.), S. 19 f. ("The idea of God, as meaning an infinitely intelligent, wise, and good Being, arises from reflecting on the operations of our own mind and augmenting, without limit, those qualities of goodness and wisdom." An Inquiry Concerning Human Understanding, sect. II: On the Origin of Ideas.)
22 Wie Humes Gottesvorstellung ist auch sein "Begriff" des "Ich" von entsprechender Seichtheit "Was ist die Seele des Menschen? Eine Zusammensetzung von verschiedenen Fähigkeiten, Gemütsbewegungen, Empfindungen, Vorstellungen, die freilich zu einem Selbst oder einer Person verbunden, aber doch voneinander unterschieden sind." Dialoge über natürliche Religion, Hamburg 4. Aufl. 1968 (Phil. Bibl.), S. 39 ("What is the soul of man? A composition
Seite 84:
of various faculties, passions, sentiments, ideas; united, indeed, into one self or person, but still distinct from each other®, Dialogues Concerning Natural Religion, part IV).
23 Kap. 11 , in der Übers. v. F. S. Schmitt, 5. 71 (... quemadmodum faber prius mente concipit quod postea secundum mentis conceptionem opere perficit), Opera omnia, Vol. I, p. 26.
24 Buch I, Kap. 1, in der Übers. v. F. S. Schmitt, S. 13 (Hoc quoque muitum me retrahit a petitione tua, quia materia non solum pretiosa, sed, sicut est de specioso "forma prae filiis hominum' (Ps. 44,3), sic etiam est speciosa ratione super intellectus hominum Unde timeo, ne, quemadmodum ego soleo indignari pravis pictoribus, cum ipsum dominum informi figura pingi video, ita mihi contingat, si tain decoram materiam incompto et contemptibili dictamine exarare praesumo.), Opera omnia, Vol. II, p. 49.
25 Kap. 1, in der Übers. v. F. 5. Schmiitt, S. 83 (vgl. o., 1. Kap., Anm. 13).
26 "All das ist schön nach Art von Bildern aufzufassen. Aber wenn kein fester Grund da ist, auf dem es ruht, scheint es den Ungläubigen nicht dafür zu genügen, warum wir glauben müßten, Gott hätte all das von uns Genannte erleiden wollen. Denn wer ein Gemälde anfertigen will, wählt einen festen Grund aus, auf dem er malt, damit bleibt, was er malt. Denn niemand malt auf Wasser oder in die Luft, weil da keinerlei Spuren des Bildes bleiben. Wenn wir daher diese von dir vorgebrachten BilIigkeitsgründe den Ungläubigen gleichsam wie Bilder eines geschehenen Ereignisses entgegenhalten, so meinen sie, weil sie ja wähnen, was wir glauben, sei nicht geschehenes Ereignis, sondern Erfindung, wir malten gleichsam auf Wolken. Es ist mithin zuerst ein vernunftgemäßer fester Untergrund der Wahrheit aufzuzeigen, das heißt die Notwendigkeit, die beweist, daß Gott zu dem, was wir verkünden, sich erniedrigen mußte oder konnte; dann sind, damit gleichsam der Leib der Wahrheit selber mehr erstrahle, jene Billigkeitsgründe wie Bilder dieses Leibes darzustellen." (Omnia haec pulchra et quasi quaedam picturae suscipienda sunt. Sed si non est aliquid solidum super quod sedeant, non videntur infidelibus sufficere, cur deum ea quae dicimus pati voluisse credere debeamus. Nam qui picturam vult facere, eligit aliquid solidum super quod pingat, ut maneat quod pingit. Nemo enim pingit in aqua vel in aere, quia nulla ibi manent picturae vestigia. Quapropter cum has convenientias quas dicis
Seite 85:
infidelibus quasi quasdam picturas rei gestae obtendimus, quoniam non rem gestain, sed figmentum arbitrantur esse quod credimus, quasi super nubem pingere nos existimant. Monstranda ergo prius est veritatis soliditas rationabilis, id est necessitas quae probet deum ad ea quae praedicamus debuisse aut potuisse humiliari; deinde ut ipsum quasi corpus veritatis plus rüteat, istae convenientiae quasi picturae corporis sunt exponendae.) Buch I, Kap. 4, in der Übers. v. F. S. Schmitt, S. 17 (Opera omnia, Vol. II, pp. 51s).
27 Vgl. schon A. Augustinus, De lib. arb. II, 3-15; De vera rel. 30-32.
28 Vgl. hierzu Ontologische Voraussetzungen, a.a.O., S. 136 f.
29 "Auch darf ich nicht glauben, ich begriffe das Unendliche nicht in einer wahrhaften Vorstellung, sondern nur durch Verneinung des Endlichen, so wie ich Ruhe und Dunkelheit durch Verneinung von Bewegung und Licht begreife. Denn ganz im Gegenteil sehe ich offenbar ein, daß mehr Sachgehalt in der unendlichen Substanz als in der endlichen enthalten ist und daß demnach der Begriff des Unendlichen dem des Endlichen, d. i. der Gottes dem meiner selbst gewissermaßen vorhergeht. Wie sollte ich sonst auch begreifen können, daß ich zweifle, daß ich etwas wünsche, d. i. daß mir etwas mangelt und ich nicht ganz vollkommen bin, wenn gar keine Vorstellung von einem vollkommeneren Wesen in mir wäre, womit ich mich vergleiche und so meine Mängel erkenne? Meditationen III (46), a.a.O., 5. 83.
30 Deutsch: Der Mensch in der Revolte, Reinbek b. Hamburg 1953.
31 Vgl. den Überblick bei J. Moltmann, Der gekreuzigte Gott, München 1973, S. 205--214.
32 F. Dostojewskij, Die Brüder Karamasoff, 5. Buch.
33 Die Pest, Hamburg 1950, S. 77.
34 "Ich verlasse Sisyphos am Fuße des Berges! Seine Last findet man immer wieder. Nur lehrt Sisyphos uns die größere Treue, die die Götter leugnet und die Steine wälzt. Auch er findet, daß alles gut ist. Dieses Universum, das nun keinen Herrn mehr kennt, kommt ihm weder unfruchtbar noch wertlos vor. Jedes Gran dieses Steins, jeder Splitter dieses durchnächtigten Berges bedeutet allein für ihn eine ganze Welt. Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen." A. Camus, Der Mythos von Sisyphos. Ein Versuch über das Absurde, Hamburg 1959, S. 101.
Seite 86:
35 Vgl. A. Camus, Die Pest, a.a.O., S. 125-128.
36 Diesen phänomenologischen Tatbestand hält auch die deutsche Sprache fest. Das Wort Sinn" hat, seiner ursprünglichen Bedeutung nach, mit Weg, Reise, Richtung' zu tun, vgl. F. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin 18 1960, S. 710.